Neue Site - empfehlenswert! Ein Ableger der Karl-Leisner-Jugend: aktueller, kürzer, frischer und moderner: www.gut-katholisch.de.
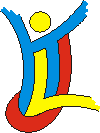 |
KARL-LEISNER-JUGEND |
Eine christliche Anthropologie
|
Es ist ein Merkmal des Menschen, dass er Offensichtliches leugnen und Unsinniges behaupten kann. Zur Zeit machen besonders die Vertreter der Gender-Mainstreaming-Ideologie von diesem Vorrecht Gebrauch: Aus dem Bemühen, Benachteiligung von Menschen aufgrund ihres Geschlechtes zu verhindern, ist inzwischen die unverhohlene Abschaffung des biologischen Geschlechtes entstanden.
Der englische Ausdruck »gender« besitzt im deutschen kein direktes Äquivalent. Im Gegensatz zum englischen »sex«, das das biologische Geschlecht bezeichne, bezöge sich »gender« auf das soziale Geschlecht - das wiederum erlernt und anerzogen sei und deshalb auch veränderbar (Simone de Beauvoir: »Frauen werden nicht als Frauen geboren, sondern dazu gemacht«). - »Mainstreaming« meint nichts anderes, als dass die gender-Perspektive in den gesellschaftlichen »Hauptstrom«, also in alle Gesellschaftsbereiche (von der Politik bis zur Religion) transportiert werden soll.
Das Ziel von gender-mainstreaming ist nicht die Vermeidung oder Aufhebung von Benachteiligung aufgrund des biologischen Geschlechts. Das Übel der Geschlechterdiskriminierung muss an der Wurzel gepackt werden: »Schon allein durch den Umstand, dass alle Welt von zwei Geschlechtern ausgeht, werden Frauen unterdrückt; folglich müssen die Geschlechtergrenzen verschwinden.« (F. Gerbert).
Der Begriff gender geht auf den Psychologen John Money zurück - einer der Pioniere der Gender-Theorie, der zu beweisen versuchte, dass »Geschlecht« als solches nur erlernt sei.
»Um seine Theorie zu beweisen, unterzog Money 1967 den knapp zwei Jahre alten Jungen Bruce Reimer einer operativen und hormonellen Geschlechtsumwandlung.« (A. Späth, »Vergewaltigung der menschlichen Identität«). Im Frühjahr 2004 erschoss sich Bruce Reimer, der zwischenzeitlich Brenda hieß und sich, als er von Moneys Eingriff an ihm erfuhr, wieder »zurückwandeln« ließ.
Auch Alice Schwarzer hat sich der Gender-Ideologie entsprechend geäußert: »Die Gebärfähigkeit (ist) auch der einzige Unterschied, der zwischen Mann und Frau bleibt. Alles andere ist künstlich und aufgesetzt, ist eine Frage der seelischen Identität.« (A. Schwarzer, »Der kleine Unterschied«, S. 192)
Philosophischer Hintergrund des Gender-Glaubens ist der Konstruktivismus - die Auffassung, dass die Welt nicht als solche und an sich existiert. Vielmehr konstruieren wir unsere Umwelt - und auch uns selbst. Meine Realität ist nur subjektiv, du lebst in einer anderen Realität, und jeder weitere Mensch ebenso. Letztlich gibt es nichts Verbindendes mehr; jede Objektivität wird abgeschafft.
Diese zerstörerische Sicht vom Menschen hat bereits C. S. Lewis in »The Abolition Of Man« - »Die Abschaffung des Menschen« beschrieben und kritisiert; ebenso Ratzinger vor seiner Wahl und während der Zeit als Benedikt XVI. im Relativismus.
Dass der Konstruktivismus eine zwar weit verbreitete Haltung ist (»Jeder Mensch kommt nach dem Tod in "seinen" Himmel«, »Jeder Mensch muss selber wissen, was gut und was böse ist«, »Jeder sieht die Welt halt anders«), macht ihn nicht plausibler. Wenn eine verbindende Wirklichkeit nicht mehr existiert, dann zerbricht alles, was den Menschen ausmacht: Jede Moral, jede Kommunikation, jede Interaktion. Und schließlich jede Identität - was vermutlich auch das Ziel des Gender-Mainstreaming ist.
Birgit Kelle hat ein Buch darüber mit dem Titel »Gender-Gaga« geschrieben, und viel mehr als »Gaga« ist an Gender auch nicht dran. Gender-Mainstreaming ist Gaga: Wäre die Auflösung der Geschlechter naturwissenschaftlich nicht untermauert, so könnte man sich ja noch auf die Forschungsfreiheit berufen. Tatsächlich ist die Behauptung, Mannsein und Frausein seien gesellschaftliche Konstrukte, durch unzählige abgesicherte Erkenntnisse eindeutig widerlegt (aus Psychologie, Hirnforschung, Medizin, Biologie, Anthropologie und Soziologie). Norwegen hat als erstes Land Europas den Gender-Mainstream-Projekten wegen erwiesener Ineffektivität alle Fördergelder gestrichen.
Halten wir fest: Mann und Frau sind verschieden in biologischer, medizinischer und psychologischer Hinsicht, und dies schon vom Beginn ihrer Existenz an. Diese Geschlechterdifferenz wird durch kulturelle, religiöse und gesellschaftliche Traditionen teilweise ergänzt (aber auch teilweise ausgeglichen). Diese zusätzliche soziale Geschlechterdifferenzierung macht sich der Mensch durch Umwelt und Erziehung zueigen; manche dieser Unterschiede (ob anerzogen oder angeboren) führen zu Ungleichbehandlungen, Ungerechtigkeiten und Diskriminierungen. Das ist verwerflich und muss dringend korrigiert werden. Die Abschaffung jeder Geschlechterdifferenz, wie sie Gender-Mainstreaming versucht, und die Behauptung, jeder Geschlechterunterschied sei ein soziales Konstrukt, führt jedoch nicht zur größeren Gerechtigkeit, sondern stellt eine Vergewaltigung der menschlichen Identität (A. Späth) dar.
Ebenfalls sollten wir - dem christlichen Menschenbild entsprechend - nicht nur von biologischen und sozialen Geschlechterdifferenzen sprechen, sondern nicht vergessen, dass der Mensch zu dem, was er ist, durch seine Seele wird. Es ist unerlässlich, auch die seelische Existenz des Menschen als weiblich-männlich zu denken. Vermutlich liegt genau hier der entscheidende Kritikpunkt der Gender-Theoretiker - obwohl diese vermutlich alle die Existenz einer Seele leugnen.
Gegenüber den Gender-Mainstreaming-Ideologien bietet die christliche Anthropologie ein weitaus positiveres Konzept: Mann und Frau sind verschieden, weil sie aufeinander hin geschaffen sind; sie finden ihr Glück und ihre Erfüllung erst in gegenseitiger Ergänzung.
In diesem Zusammenhang das Wort »Hierarchie« zu verwenden, ist gewagt: Unsere heutige Gesellschaft und Medienpolitik möchte am liebsten jede Hierarchie verbannen - denn, so macht man uns glauben, in der Unter- und Überordnung liegt immer eine Ungerechtigkeit und Diskriminierung. Aber genau das Gegenteil ist der Grundzug des christlichen Geschlechterverständnisses: Erst durch gegenseitiges Lehren und Hinhören, Geben und Annehmen, Schenken und Empfangen verwirklicht sich der Mensch. Das, was der Mann nicht gut kann, empfängt er von seiner Frau durch seine persönliche Unterordnung unter ihr Können. Das, was die Frau nicht gut kann, empfängt sie von ihrem Mann auf die gleiche Weise.
Es fällt uns nicht schwer, den ersten Satz auszusprechen: »Der Mann erfährt sein eigentliches Wesen dadurch, dass er die Frau in ihren weiblichen Eigenschaften als Ergänzung seiner eigenen Unvollständigkeit würdigt und sich ihrem Können unterordnet.« - Die umgekehrte Formulierung geht uns dagegen kaum über die Lippen: »Die Frau erfährt ihr eigentliches Wesen dadurch, dass sie den Mann in seinen (typisch) männlichen Eigenschaften als Ergänzung ihrer eigenen Unvollständigkeit würdigt und sich seinem Können unterordnet.« - Wenn aber der erste Satz nicht diskriminierend ist, dann auch nicht dessen Umkehrung in der zweiten Formulierung.
Über das, was »typisch Mann« und »typisch Frau« ist, wollen wir hier nicht weiter nachdenken.
Sowohl Johannes Hartl (»Die Kunst eine Frau zu lieben« / »Die Kunst, (m)einen Mann zu lieben«), als auch Shaunti & Jeff Feldhahn (»Männer sind Frauensache« / »Frauen sind Männersache«) und Allan & Barbara Peas (»Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken«) haben dazu kluge und zugleich witzige Bücher geschrieben.
Fazit ist allemal, dass der Geschlechterunterschied eine Hierarchie beinhaltet - die aber keine Wertung darstellt! Das ist sicherlich erklärungsbedürftig: In der modernen, als »kapitalistisch« gedachten Gesellschaft ist der Chef der Ausbeuter und der Untergebene das Opfer. Und da keiner gerne Opfer ist, wollen alle möglichst Chef sein; sich unterzuordnen heißt ein Verlierer zu sein. - Der Fehler in diesem Schluss liegt bereits in der Ausgangsthese: Chef sein (zum Beispiel einer Firma) ist sehr wohl ein Dienst; der Leiter eines Schulkollegiums ist ganz sicher nicht der Ausbeuter, sondern der notwendige Orientierungspunkt. Das Papstamt ist sicher kein viel gefragter Ausbildungsberuf, sondern (für die Person des Papstes) eher das Ende der meisten persönlichen Träume und Freiheiten.
Das trifft sicherlich nicht immer zu; immerhin leben wir ja in einer Gesellschaft mit doch noch kapitalistischen Anteilen. Aber dort, wo Gesellschaft, Familie und Verein im Guten funktionieren, muss jemand leiten und Verantwortung übernehmen. Am besten derjenige, der es kann und es als Dienst versteht. Auf der anderen Seite bedarf der »Chef« der Anerkennung seiner Position, der Erlaubnis, diese auszufüllen und der positiven Unterstützung. Wer Verantwortung übernimmt, braucht jemanden, der ihm diese Verantwortung vertrauensvoll überlässt und ihn dazu ermutigt. Außerdem muss jemand, der entscheidet, bei den anderen genau hinhören, was seine Entscheidungen bedeuten und bewirken können. Dafür braucht der »Leiter« das Wohlwollen der »Geleiteten« - auf diese muss er hören, mit ihnen denken und sie achten.
Noch habe ich diese Rollen keinem bestimmten Geschlecht zugeordnet - und tatsächlich ist die Zuordnung auch manchmal überraschend anders verteilt. In jedem Verein, in der Kirche, Gesellschaft und in der Familie soll man die Aufgabe übernehmen, für die man geschaffen wurde; aber auch wenn das eine Leitungsfunktion ist, bleibt es ein Dienst!
Ich möchte an dieser Stelle nicht weiter ausführen, ob und warum und in welcher Hinsicht der Mann eine andere Berufung hat als die Frau. Es ist jedoch nicht sofort eine Diskriminierung der Frau, wenn Paulus schreibt:
Eph 5, 21-27: Einer ordne sich dem andern unter in der gemeinsamen Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn (Christus); denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Kirche ist; er hat sie gerettet, denn sie ist sein Leib. Wie aber die Kirche sich Christus unterordnet, sollen sich die Frauen in allem den Männern unterordnen.
Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat, um sie im Wasser und durch das Wort rein und heilig zu machen. So will er die Kirche herrlich vor sich erscheinen lassen, ohne Flecken, Falten oder andere Fehler; heilig soll sie sein und makellos.
Zugegeben, Paulus hat es mit diesen Aussagen heutzutage schwer. Aber vielleicht wird es leichter nachvollziehbar, wenn wir vom Inneren zum Äußeren denken: Die Bestimmung und Erfüllung der Mutter ist es, das Baby mit ihrer Liebe und ihrem Wesen zu beschützen und zu umhüllen. So ist es die Bestimmung und Erfüllung des Vaters, die Mutter mit ihrem Kind mit der väterlichen Liebe und seinem Wesen zu beschützen und zu umhüllen. So ermöglicht er der Frau, Mutter zu werden. Und wiederum ist es die Freude und Erfüllung Jesu Christi, den Vater (und damit auch die Mutter mit ihrem Kind) mit seiner göttlichen Liebe und seinem Wesen zu beschützen und zu umhüllen. So ermöglicht er dem Vater, Hüter seiner Frau zu sein - damit diese die Freiheit hat, Mutter zu werden - damit das Kind in einem behüteten Raum der Freiheit heranwächst.
Aber ist der Mensch denn ausschließlich zum Vater- und Muttersein geschaffen? - Dieser Einwand ist wichtig. Ja, es stimmt: für viele Menschen vollzieht sich ihr Dasein nicht in der Ehe (was übrigens in früheren Zeiten auch nicht anders gewesen ist; der Prozentsatz der Menschen, die eine Familie gründen, hat nicht abgenommen - die Anzahl ihrer Kinder allerdings schon). Aber dennoch bleiben auch alle anderen hineingenommen in den Dienst an den Familien, ob Priester oder Ordensleute, ob unverheiratete Tanten oder Onkel, ob freiwillige Singles oder »Übriggebliebene«: Sie alle haben ihre Aufgabe, die sich in Analogie zur paulinischen Sicht der Geschlechter bestimmen lässt.
In seinen 129 Mittwochskatechesen von 1979-1984 hat Papst Johannes Paul II. eine Theologie entworfen, die allgemein als »Theologie des Leibes« bezeichnet wird. Dabei ist sie viel mehr: Sie ist eine Theologie des Menschen, der seine Heiligkeit durch die ihm eigene Geschlechtlichkeit findet.
Die Philosophen der griechischen Stoa verabscheuten den Kontrollverlust im Orgasmus, weil sie dadurch den Menschen wieder auf die Ebene des Tieres herabsinken sahen. Der Mensch war ihrer Meinung ja nur deshalb Mensch, weil er seine Triebe beherrschen und durch die Vernunft (ratio) steuern konnte. Die Sexualität war zwar zur Zeugung von Nachkommen notwendig, aber ansonsten tunlichst zu vermeiden; der Geschlechtsakt schien dem Wesen des Menschen entgegengesetzt zu sein.
Im Christentum wurde dieses Denken nach und nach überwunden; der Geschlechtsakt wurde im Laufe der Theologiegeschichte sogar zum Vollzug des Ehesakramentes aufgewertet. Aber letztlich fanden sich in Mann und Frau vor allem zwei defizitäre Wesen zusammen, die einander ausglichen, was dem einen oder anderen jeweils fehlte.
Papst Johannes Paul II. hat in seinen Mittwochskatechesen nun nicht die Rolle des Leibes oder der Sexualität revolutioniert; obwohl ihm unbestritten der Verdienst zukommt, dieses Thema erstmalig (durch einen Papst!) offen, theologisch und vom Menschen her denkend in den Fokus der Theologie gestellt zu haben. Das eigentlich Revolutionäre ist dagegen, dass die Geschlechtlichkeit des Menschen nicht ein Defizit in der Gottebenbildlichkeit darstellt, das durch die Lebens- und Liebesgemeinschaft der Ehe ausgeglichen wird. Vielmehr sind Mann und Frau bereits für sich Ebenbild Gottes und spiegeln in ihrer Geschlechtlichkeit Züge Gottes wider. In der Hinordnung auf die jeweiligen Vorzüge des anderen Geschlechts - auch die sexuell-leibliche Hinordnung! - gelangt der Mensch erst zur Eigentlichkeit und Heiligkeit. Erst indem er die eigene positive Geschlechtlichkeit als Mann oder als Frau anerkennt, kann der Mensch zu Gott finden.
Nachzulesen: Johannes Paul II., Norbert und Renate Martin (Hrsg.): Die menschliche Liebe im göttlichen Heilsplan. Eine Theologie des Leibes. Mittwochskatechesen von 1979 â 1984 Verkürzt und nicht mehr theologisch ganz angemessen ist: Christopher West: Theologie des Leibes für Anfänger - Einführung in die sexuelle Revolution nach Papst Johannes Paul II.
Die Frage nach dem Woher des Leids in der Welt und des Bösen im moralischen Handeln des Menschen ist seit jeher eine Nagelprobe theologischer Weltdeutung. Bereits Epikur leitete aus der Differenz zwischen dem Sosein der Welt und dem gedachten Sein der Götter einen unlösbaren Widerspruch ab: Entweder Gott ist nicht gut (das erklärt, warum die Welt es ebenfalls nicht ist), oder er ist nicht allmächtig (was die Schlechtigkeit der Welt zumindest möglich werden lässt). Er kann aber nicht beides sein - gut und allmächtig - denn dann wäre die Welt nicht so, wie sie ist: mangelhaft. Das widerspräche allerdings dem Wesen Gottes.
Die Antwort des christlichen Glaubens ist aber nicht bloß eine Reaktion darauf, sondern erweist sich als anthropologischer Geniestreich: Der Mensch ist gut erschaffen, aber gefallen - aufgrund einer ihm von Gott geschenkten Eigenständigkeit.
Die Theologie antwortet zunächst auf die Frage der Theodizee: Gerade weil der Mensch in seiner Gottebenbildlichkeit auch frei in seinem Handeln ist, ist er frei, sich gegen seinen eigenen Schöpfer zu entscheiden und damit gegen seine Bestimmung, gut zu sein.
In dieser Antwort liegt aber zugleich eine Wirklichkeitsbeschreibung, die den Menschen treffender beschreibt als andere anthropologische Entwürfe aus Antike und Neuzeit, Philosophien und Weltreligionen. Während die Charakterisierung des Menschen als in sich schlecht (Hobbes: »hominus hominem lupus est« - »Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf«) an der Realität der großen und kleinen Selbstlosigkeiten und Ideale vorbeisieht, leugnet die Verherrlichung des natürlich gebliebenen Menschen (Rousseau: »Zurück zur Natur!«) die Abgründe der Unmenschlichkeit, mit der sich der Mensch in allen Epochen der Geschichte selbst konfrontiert.
Erst die Lehre vom Menschen als »geschwächter Heiliger« findet ein Mittelmaß, das die beiden Thesen (von Natur aus böse - von Natur aus gut) in einem anthropologischen Entwurf verbindet: Der Mensch ist gut geschaffen und zu Höherem auserwählt, aber er ist gefallen und fällt immer wieder, wenn er sich nicht aufrichten lässt von dem, der ihm aus der Höhe zu Hilfe kommt. Somit ist der Mensch nicht nur offen für Religiösität oder in seinem Menschsein unvollständig ohne eine Beziehung zu Gott; er bedarf vielmehr zur Verwirklichung menschlicher Größe des Zuspruches Gottes. Diesen Zustand des Menschen zwischen Gut und Böse nennt die Kirche »erbsündliche Verfassung«.
Der Begriff der Erbsünde darf nun (erstens) nicht überzogen werden, wie es die Reformatoren getan haben. Anders als diese geht die katholische Kirche davon aus, dass das Gute im Menschen geschwächt, aber nicht getötet ist; seine Freiheit ist eingeschränkt, aber nicht verloren; seine Natur ist verwirrt, aber nicht verdorben; die Erkenntnis verdunkelt, aber nicht verhindert. Wie ein Magnet die Eisenspäne wieder »in Ordnung« bringt, so richtet die Gnade Gottes die natürlichen Kräfte des Menschen wieder auf das ursprüngliche Ziel aus. Dennoch sind auch ohne den Magneten die Eisenspäne vorhanden; auch ohne die Gnade ist der Mensch mit Gottes guten Gaben ausgestattet.
Zudem ist (zweitens) der Begriff »Sünde« nicht aktuell, sondern nur habituell zu verstehen: Der Mensch ist zwar von Geburt an dem ursprünglichen Schöpfungszustand entfremdet (habituelle Sünde meint ein Sein, das vom Guten abgesondert ist), wird aber erst persönlich schuldig, wenn er eine eigene Tat der Auflehnung gegen das sittliche Ideal setzt (aktuelle Sünde meint ein handelndes Absondern vom Guten). Die Erbsünde ist also keine persönliche Schuld, sondern ein Zustand, in dem der Mensch gleichermaßen von Gut und Böse angezogen ist - während der ursprüngliche, gottgewollte Zustand beinhaltet, vom Guten angezogen und vom Bösen abgestoßen zu werden. Das biblische Bild des Essens vom Baum der »Erkenntnis von Gut und Böse« beschreibt diese freiwillige Neutralität: Gut und Böse gleichermaßen zu erkennen und zu verinnerlichen heißt, nun auch dem Guten neutral gegenüber zu sein.
Zuletzt ist (drittens) der Begriff der »Vererbung« weder rein sozial zu verstehen (»Ich werde in eine ungerechte Welt geboren, so bleibt mir nichts anderes übrig, als mich in den Strukturen dieser Welt schuldig zu machen.«), noch biologistisch im Sinne eines »Gendefektes«. Vielmehr handelt es sich um eine geistige Wirklichkeit, die verloren gegangen ist: Mit der Erbsünde hat der Mensch seine natürlich eingesenkte Vorliebe für das Gottgewollte verloren; diese Vorliebe kann seitdem auch nicht mehr an nachfolgende Generationen vermittelt werden.
Schon aus der christlichen Erbsündenlehre (»Der Mensch ist gut geschaffen und zu Höherem auserwählt, aber er ist gefallen und fällt immer wieder, wenn er sich nicht aufrichten lässt von dem, der ihm aus der Höhe zu Hilfe kommt«) ergibt sich die Hinordnung des Menschen auf eine Hilfe von außen. Diese Angewiesenheit ist allerdings nicht erst eine Folge der Sünde: Schon vor dem Sündenfall (im zweiten Schöpfungsbericht) beschließt Gott, dass es nicht gut sei, wenn der Mensch alleine bliebe (Gen 2,18-25). Der Mensch ist nur Mensch, wenn er dazu eine Hilfe erfährt. Gott führt ihm die Tiere zu und schließlich »als Fleisch von meinem Fleisch« die Frau. Der Mensch vollendet also sein Wesen, indem er in Beziehung tritt: Zur Schöpfung, zu den anderen Menschen und zu Gott. Ohne diese »Ergänzung« ist der Mensch unvollkommen und unfertig. Sünde ist, in der Beziehungsfähigkeit Schaden zu nehmen und sich damit vom erfüllten Leben zu entfernen.
Daraus ergibt sich aber auch, dass unsere Heiligkeit sich nicht in der autonomen Perfektion erfüllt. Wer so perfekt ist, dass er niemanden mehr nötig hat, ist nicht heilig, sondern wahrnehmungsgestört. Heiligkeit findet sich nur in der (vollkommenen) Beziehung zu dem, der mich ergänzt und somit »heiligt«.
In den meisten Religionen gibt es bedürftige Götter, die dem Menschen Pflichten auferlegen, damit ihre Bedürfnisse (nach Verehrung, Opfer oder Gebet) erfüllt werden. Als Gegenleistung versprechen sie dem gläubigen Menschen Schutz, Wohlergehen und das göttliche Wohlgefallen.
Unser jüdisch-christlicher Gott ist anders; das wird spätestens an den Zehn Geboten deutlich, deren Erfüllung Gott als Bundesleistung des Menschen verlangt. Anstatt Opfer, rechten Gottesdienst, den Zehnten Teil der Feldfrüchte oder die Einhaltung bestimmter Rituale zu verlangen, besteht die Forderung Gottes an Sein Volk darin, dass dieses die Beziehungen zu Gott und untereinander schützt! Wohlgemerkt: Nicht das Wohlergehen Gottes, sondern das Wohl der Menschen ist der Gegenstand der Zehn Gebote. Gott erwartet also nichts für sich - Sein Glück besteht darin, die Beziehungsfähigkeit Seines Volkes wiederhergestellt zu sehen. Gottes Glück besteht darin, Sein Volk glücklich zu sehen.
Wenn nun Gott schon in sich ein Beziehungsgeschehen ist, dann muss es auch der Mensch sein, der als Ebenbild Gottes geschaffen wurde.
Somit ist die Erfahrungswirklichkeit, dass der Mensch seine größte Erfüllung findet, wenn er anderen zur Erfüllung verhilft, auch theologisch und biblisch gut begründet. Dieses darf getrost als eine Grundwahrheit unseres christlichen Glaubens betrachtet werden: »Glücklich wird, wer glücklich macht!«. Wir werden erst dann Gott ähnlich sein, wenn wir wie er das Glück und das Wohl des anderen im Blick haben.
Wenn darin nun eine Grundkonstante des Menschseins liegt - und nicht nur ein Defizit aufgrund des Sündenfalls -, dann liegt hierin auch das Glück des Jenseits. Wir werden im Himmel nicht »autonom perfekt« sein, sondern bleiben aufeinander und auf Gott angewiesen. Diese Angewiesenheit aber nicht als Last zu erfahren, sondern als wunderbare Gelegenheit, den anderen groß sein zu lassen und zu erheben, indem ich ihn um Hilfe bitte (und umgekehrt), ist »Himmel«. Sein eigenes »Defizit« als Gnade anzusehen, die einem anderen die Möglichkeit schenkt, mich zu ergänzen, ist »Himmel«. Einem anderen zu Hilfe zu kommen und darin einen Grund zur Freude für ihn und für mich zu entdecken, ist »Himmel«.
Ein Himmel, der hier auf Erden nur ein blasses Abbild ist, weil wir unsere Hinordnung auf den anderen immer noch nicht als Gnade, sondern zumindest auch als Last empfinden.
Bereits Aristoteles bezeichnete den Menschen als »animale rationale« (da er griechisch schrieb, natürlich als »zoon logikon«); der Gebrauch der Vernunft, die zur Herrschaft über die Triebe berufen ist, macht den Menschen erst zum Menschen. Kant bemerkte hierzu richtig, dass der Mensch zunächst nur ein »animale rationabile« sei - also ein zum Vernunftgebrauch fähiger Mensch - diesen Gebrauch muss er nämlich auch wollen, einüben und praktizieren. Der Mensch ist also durch seine Begabung mit Geist bereits von der Tierwelt unterschieden; wenn er aber diese Gabe nicht ausbildet, bleibt er hinter seinen Möglichkeiten zurück und damit auch hinter seiner Menschlichkeit.
Wir sind also aufgerufen, noch zu dem zu werden, was wir in der Anlage bereits sind: Wesen, die zur Erkenntnis der Wahrheit fähig sind. Die Wahrheit zu suchen, zu erkennen, anzunehmen und weiterzugeben, ist ein Geschenk Gottes an den Menschen und zugleich seine Aufgabe. Aber nicht eine Aufgabe, die dem Menschen einiges kostet und ihm abverlangt, sondern die ihn erst zu dem werden lässt, was er sein kann. Der Mensch als »animale rationale« ist also nicht nur wahrheitsfähig, sondern zur Erkenntnis der Wahrheit geschaffen und berufen.
Das gleiche gilt für eine zweite Wesensbestimmung des Menschen: Er ist frei, das Gute zu tun und das Böse zu meiden. Der Mensch ist mit einer Freiheit ausgestattet, die ihn ebenfalls vom Tier unterscheidet. Das Tier ist, was es ist, und tut, was es tut. Das Tier hat dabei keine von seinem Handeln unabhängige Intention - selbst, wenn das Verhalten einzelner Arten (Menschenaffen, Delphine, Papageien, Dohlen, Elefanten und Hunde - zum Beispiel) dem selbstbestimmten Handeln des Menschen verblüffend ähnelnt.
Für die Freiheit gilt das gleiche wie für die Vernunft (oder auch die Sprache und das Gewissen): Alle Menschen haben diese Gabe von Anfang an; die Begabung jedoch muss ausgebildet und zur Anwendung gebracht werden, sonst verkümmert sie.
Der Mensch ist aufgerufen, das Gute zu erkennen und in seinem Handeln zu verwirklichen. Der Mensch ist zum Guten fähig. Das Gute zu suchen, es zu erkennen, zu verwirklichen und andere dazu anzuhalten, ist ein Geschenk Gottes an den Menschen und zugleich seine Aufgabe. Die Erfüllung dieser Aufgabe jedoch führt zur eigentlichen Bestimmung des Menschen, nämlich zur Fülle der Freiheit zu gelangen.
Auch dieser Ausdruck stammt von Aristoteles: Der Mensch ist von seinem Innersten her ein Gemeinschaftswesen. Wahrheit, Sprache, Gewissen und Freiheit dienen dem Ziel, in Freundschaft mit allen anderen Personen zu leben. Darin erfüllt sich sein eigentliches Wesen, dort findet er sein Glück.
Für uns Christen ist klar, dass wir all diese Gaben nicht wirklich zur Blüte bringen können, ohne dass uns dabei unter die Arme gegriffen wird. Wir sind also nicht nur zur Gemeinschaft mit allen Wesen gerufen - wir gelangen dorthin nur, wenn wir die Hilfe anderer Wesen annehmen. Die entscheidende Hilfe (wir Christen sagen auch: Erlösung) gewährt uns jenes Wesen, das Person schlechthin ist: Gott, der Vater; Gott, der Sohn und Erlöser; Gott, der Heilige Geist.
Die »Gemeinschaft der Heiligen« ist also nicht nur ein Ziel des Menschen, sie ist auch sein Weg. Grund für die Erlangung dieses Zieles ist jedoch immer derjenige, der uns darauf hin geschaffen hat; der uns den Weg dorthin gebahnt hat und der uns mit der Kraft ausstattet, sich zur Wahrheit, Freiheit und Liebe führen zu lassen.
