Neue Site - empfehlenswert! Ein Ableger der Karl-Leisner-Jugend: aktueller, kürzer, frischer und moderner: www.gut-katholisch.de.
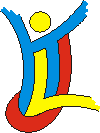 |
KARL-LEISNER-JUGEND |
Die Zukunft der Gemeinden: Entwurf einer Gemeindetheologie
|
a. Gott ist Familie. - Wesentlicher Ausgangspunkt für eine christliche Theologie, Pastoral und auch Liturgie ist das Gottesbild: Gott ist in sich nicht ein starrer Block eines in sich ruhenden »Unbewegten Bewegers«, sondern Gott ist dreifaltiges Leben: Eine Gemeinschaft von drei Personen in nur einem Wesen. Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist sind in ihrem Beziehungsreichtum und Beziehungsgeschehen Urbild der Schöpfung, des Menschen und der Kirche.
Diese Berufung zur Gemeinschaft wurde gestört durch den Sündenfall - wobei Sünde nicht in erster Linie eine Gebotsübertretung, sondern eine Beziehungsstörung ist. Diese zieht eine Haltung nach sich, die sich bis heute als Sündhaftigkeit des Menschen zeigt und theologisch Erbschuld genannt wird, aber wohl treffender mit Beziehungsangst umschrieben wird.
Nun knüpft Gott selbst wieder die heilende Beziehung zum Menschen in der Menschwerdung seines Sohnes und nimmt auf diese Weise die menschliche Natur in das Innerste der trinitarischen Liebesgemeinschaft auf. Durch Seinen Tod am Kreuz nimmt er allen Menschen den tiefsten Grund, sich dieser Gemeinschaft zu verweigern: Die Angst vor der eigenen Unzulänglichkeit im Angesicht Gottes.
b. Familie als Grundmodell der Kirche. - Annahme der Erlösung Jesu Christi geschieht also durch Einüben in die geschenkte Beziehung; jeder Getaufte, der seine eigenen Beziehungsunfähigkeiten zu überwinden sucht, wird allmählich zu einem neuen, wahrhaft christlichen Menschen. Dabei ist es für einen Christen nicht entscheidend, ob er sich überwiegend in die Beziehung zu einem Menschen (z.B. in der Ehe) oder in die Gottesbeziehung einübt (z.B. in einem Orden): Erneuerte Beziehungsfähigkeit führt immer zu einem erlösteren Verhältnis zu Gott und den Menschen. Schließlich geht es um das erneuerte Sein des Menschen.
Dieses gnadenhafte Einüben in wahre Beziehung ist eine Einübung in den Himmel, in die himmlische Herrlichkeit. Denn diese ist nichts anderes als die erfüllte, angstfreie und lebendige Beziehung zu Gott und den Geschöpfen. In diese himmlische Wirklichkeit wird nach dem Zeugnis der Hl. Schrift derjenige eingelassen, der Einlass erbittet (»Denn wer bittet, der empfängt; wer sucht, der findet; und wer anklopft, dem wird geöffnet.« - Mt 7, 8). Jeder ist »im Himmel« willkommen. Hindernis könnte allenfalls die eigene unerlöste Beziehungsangst sein, die sich vor dem Licht Gottes verbergen will.
»Denn mit dem Gericht verhält es sich so: Das Licht kam in die Welt, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht; denn ihre Taten waren böse. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit offenbar wird, dass seine Taten in Gott vollbracht sind.« Joh 3, 19-21
Dieses gnadenhafte Einüben in wahre Beziehung ist aber nicht nur eine Einübung in den Himmel, es ist gleichzeitig eine Vorwegnahme der himmlischen Freuden - wenn auch nur in einem trüben Bild. Die Freuden, zu lieben und geliebt zu werden, sind dennoch wahrhaft himmlische Freuden.
Somit ist jede gottgewollte und durch Gott getragene Beziehung Vorwegnahme des Himmels und gleichzeitig deren Einübung; sie ist Annahme der Erlösung und gleichzeitig Vermittlung der Erlösung an andere. Dies gilt besonders für die Keimzelle allen Beziehungsgeschehens: Die menschliche Familie. Sie ist Keimzelle des gelebten Liebes- und Beziehungsgeschehen, des Glaubens an die Liebe der anderen und der Hoffnung auf Verzeihung und Neuanfang. Der menschlichen Familie ähnlich ist das klösterliche Leben in einer Glaubensgemeinschaft, die Gott sucht; ebenso ist das Verhältnis des Priesters zur Gemeinde auf die Ehe hingeordnet und erfährt von ihr seine Legitimation. Alle sind wiederum Ebenbild der göttlichen »Familie«, der Dreifaltigkeit.
So, wie Gott der Quell aller Gnaden ist, wird auch jede familiäre Gemeinschaft, die sich gegenseitig durch ihr Beziehungsgeschehen in den Himmel führt, zur Quelle der Gnade auch für andere (Joh 4, 14), wenn diese nur Zeugen dieser Liebe sind. So werden wir zum Licht für andere und zum Licht für die Welt (Mt 5, 13).
c. Dem Bild der Familie ist auch die Kirche gleichgestaltet. - Die Kirche ist nämlich kein bloßer Zusammenschluss von Glaubenden. Sie ist schon gegründet worden, bevor sie überhaupt Mitglieder hatte. Nicht die Mitglieder haben die Kirche ins Leben gerufen, die Kirche hat ihre Mitglieder ins Leben gerufen: Jesus Christus selbst ist der Mittelpunkt und Ausgangspunkt der Kirche. Als Jesus Christus Mensch wurde, begann bereits die Zeit der Kirche, denn die Kirche ist der Leib Christi. Seit der Geburt Jesu begann die göttliche Familie zu wachsen. Alle, die Jesus aufnahmen, konnten Kinder Gottes werden. Nicht zunächst ein Glaubensverein, sondern eine Familienzugehörigkeit kennzeichnete den Beginn eines Kreises, den wir später Kirche nennen werden.
Der Kreis der Familienangehörigen Jesu war zunächst auf den engsten Familienkreis beschränkt: Auf Maria und Josef. Dieser Kreis wurde zum ersten Mal erst dreißig Jahre später erweitert, als Jesus zwölf Jünger (in Anlehnung an die zwölf Stämme Israels) in seine Nachfolge berief - und wurde mit dem Taufbefehl (Mt 28, 28) auf alle Menschen ausgedehnt.
So ist es biblisch und schöpfungstheologisch sinnvoll, von der Gemeinde als Pfarrfamilie zu sprechen und dem Pfarrer als pater familias. Damit ist nicht etwa ein im Clan-Denken verhafteter »Patriarchalismus« (eine Vaterherrschaft) gemeint, sondern das geklärte, in Gott selbst gegebene Vorbild des Vaters, der uns in Christus offenbart ist: Dieser schafft durch seine Autorität Freiräume, in denen sich die Familienmitglieder entwickeln und entfalten können. Der Vater (bzw. Pfarrer) wirkt nicht in erster Linie durch bestimmte Leitungsfunktionen, sondern vor allem durch seine Anwesenheit, sein Mitfühlen und dabei-Sein - und vor allem durch seine Liebe zur Familie, in der sich die Liebe Christi zu den Erlösten verwirklicht.
So verwirklicht sich im Zölibat des Priesters nicht ein Bild der Enthaltsamkeit, sondern ein Leben in Hingabe: Wie der Ehemann seiner Frau und Familie Liebe verspricht und lebt, verspricht sich der Priester der Gemeinde und dient ihrem Heil - und verwirklicht so sein eigenes Christsein, indem er Christus in der Gemeinde liebt (Klaus Berger, Zölibat). Gott selbst ist Vorbild der Familie und die Familie wiederum Vorbild der Kirche in all ihren Ebenen.
a. Jeder Getaufte ist eine Vergegenwärtigung Christi. - Somit sind alle Getauften, die sich um eine gelebte Annahme der Gnade bemühen, indem sie in Beziehungen eintreten und diese christlich gestalten, lebendige Vergegenwärtigung Jesu und im eigentlichen und vollen Sinne Kirche. Sie verwirklichen das Allgemeine Priestertum aller Gläubigen und halten Christus so in unserer Welt lebendig gegenwärtig. Sie sind die Bibel, die die Menschen von heute noch lesen (Teresa von Avila).
Kirche im eigentlichen und im vollen Sinne sind also die Getauften in ihrer Gesamtheit und in ihrem alltäglichen Tun. Die Amtskirche sind deshalb alle Inhaber des ersten und ursprünglichen Amtes, des allgemeinen Priestertums. Die Unfehlbarkeit ist der Kirche nicht in einzelnen Gliedern zugesagt, sondern der Kirche in ihrer Ganzheit: »Ich aber sage dir: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen.« (Mt 16, 18)
b. Den Getauften zugeordnet ist der Dienst des geweihten Priesters und die Hierarchie der Kirche. - Nicht das Volk der Gläubigen ist auf die Unfehlbarkeit des Papstes bezogen, sondern dieser erhält seine (materiale) Unfehlbarkeit durch das Schauen auf das Wirken des Geistes in den Getauften. Nicht das Volk ist auf das Amt des Bischofs bezogen, sondern dieser erhält seine Hirtenaufgabe im Auftrag, die Herde zu weiden; der Bischof ist nur insofern Bischof, indem er der Herde dient. Nicht das Volk ist auf das Amt des Priesters bezogen, sondern der Priester (und insbesondere der Pfarrer) erhält seine Daseinsberechtigung allein durch den sakramentalen Dienst an den Getauften, um diese in ihrem allgemeinen Priestertum zu befähigen, zu erhalten und zu stärken.
Der Priester ist zwar durch das besondere Weihepriestertum beauftragt, Sakramente zu spenden, deren Vollzug nicht im allgemeinen Priestertum enthalten ist. Aber immer (!) dient die Spendung und der Empfang der Sakramente der Heiligung der Getauften, mit anderen Worten: deren Beziehungsfähigkeit - sowohl der Beziehungsfähigkeit Gott gegenüber, als auch der Fähigkeit, erfüllte Beziehungen zu den anderen Menschen zu knüpfen.
c. Christus wirkt in der Kirche - die Kirche in den Getauften - die Getauften in der Welt. - Obwohl wir in allen Gliedern des Leibes ihre unverzichtbare Aufgabe im Leib (bewirkt durch den einen Geist) erkennen, heißt das nicht, dass es keine Ordnung und keine Hierarchie gäbe.
Gerade die Predigt des Paulus im ersten Korintherbrief versucht genau das zu betonen: Nur, weil einer ein hohes Amt innehat, steht ihm nicht mehr Ehre zu als dem, der ein niedriges Amt bekleidet. Dennoch hält Paulus daran fest: Es gibt diejenigen, die als Apostel lehren - und diejenigen, die darauf hören (1 Kor 12, 12-31a). Die Autorität der Eltern, des Pfarrers, des Bischofs und des Papstes ist immer eine Verwirklichung von Hierarchie, die Freiheit garantieren soll. Dabei ist jeder auf jeden angewiesen - und alle auf das Wirken des Geistes.
Denn durch den Dienst der Hierarchie wird nicht das Recht der Gläubigen beschnitten, sondern durch die gegenseitige Einordnung ergibt sich erst deren Wirksamkeit: Der Papst nimmt weder den Eltern die Entscheidung über die richtige Erziehung ab, noch könnte er die Theologie durch Beschluss dazu bringen, etwas Falsches als richtig zu erkennen. Jeder Pfarrer muss erkennen, dass er den Mitgliedern seiner Pfarrei zwar Mut machen kann, ihren Glauben auch in der Alltagswelt zu bezeugen, aber ob und wie das geschieht, liegt nicht in seiner Verantwortung und auch nicht in seiner Macht.
Vielmehr verwirklicht sich das sakramentale und liturgische Tun des Priesters (auch das der Predigt) erst im Leben der Gläubigen. Sie tragen die eigentliche Botschaft in die Welt, indem sie sie leben. Das Tun des Papstes, der Bischöfe und der Priester ist also ein Wirken an den Getauften, und die Getauften sind dazu berufen und durch den Dienst des Amtes befähigt, an der Welt zu wirken.
a. Personalität: Anteilnahme am Leib Christi ist höchst individuell. - Es wäre ein falsches biologisches Bild, wenn der Schnittpunkt zwischen Leib und Seele nur im Gehirn angesiedelt wird: Vielmehr durchwirkt die Seele den Leib ganz und gar bis in die kleinsten Zellen hinein. Alles, was lebt, ist seelendurchwirkt.
Ebenso wirkt Christus im Leib der Kirche nicht nur in deren Haupt oder deren Leitung, sondern bis in die kleinsten Einheiten der Kirche hinein - die Familien, Verbände, Vereine, Gemeinschaften und in jede Beziehungsebene. Hierarchie garantiert dabei die Freiheit der einzelnen Glieder der Kirche - vor allem auch die Freiheit, anders zu wirken und anders zu sein. Eltern sind nicht Pfarrer, Lehrer nicht Papst, die Theologen nicht die Medien. Und selbst die Eltern haben noch eine unterschiedliche, aufeinander bezogene Rolle von Vater und Mutter; Theologen haben unterschiedliche Ansätze und ergänzen sich, ebenso die Bischöfe dieser Welt, die erst im Kollegium vereint mit dem Bischof von Rom zu verbindlichen Lehrentscheidungen befähigt sind.
b. Solidarität: Die Verwirklichung der Ebenbildlichkeit geschieht in der Nächstenliebe. - Während die Hierarchie auf die liebevollen Ermöglichung von Freiheit und Eigenständigkeit der Familienmitglieder ausgerichtet ist, ist die Einordnung in die Hierarchie als Hörende und Empfangende nicht nur ein Unterordnen, sondern ein Wachsen in der Beziehungsfähigkeit. Jede Liebe bedarf der Begabung zum Hinhören, sich Einordnen und Zurücknehmen um des anderen Willen.
Darin und darüberhinaus verwirklicht sich das Wesen der Kirche in der tätigen Nächstenliebe, die nicht im Widerspruch zu Amt und Ordnung der Kirche steht, sondern sich daraus ergibt und deren Frucht ist. Besonders im Leben von Ordensmitgliedern wird der Zusammenhang zwischen Gehorsam (im Orden) und Hinhören auf die Bedürfnisse (der Welt) deutlich. Das eine ist ohne das andere nicht denkbar, denn im Einordnen üben wir uns in das ein, was wir in der Hingabe leben.
So ist jeder Christ dazu aufgerufen, sich in die Herde des Guten Hirten (Joh 10) einzuordnen - und gleichzeitig in der Ebenbildlichkeit Christi selbst zum Hirten für andere zu werden. Jeder Christ kann aber nur Hirt für andere sein (und ebenso jeder Pfarrer und jeder Bischof), wenn er gerne und mit ganzem Herzen als Teil der Herde auf Christus hören kann.
c. Subsidiarität: Demut und Vertrauen auf die Möglichkeiten des Einzelnen. - Entgegen hartnäckigen Gerüchten, der Papst habe dank seiner Unfehlbarkeit nahezu unbegrenzte Macht, spricht ein einfacher Blick auf die Struktur der Kirche: Diese zeichnet sich nämlich durch eine äußerst »flache Hierarchie« aus - und damit durch eine Freiheit und Selbstverantwortlichkeit unterer Ebenen, die im »System Kirche« wesentlich grundgelegt ist. Ein global player wie die katholische Kirche mit nur drei Hierarchie-Ebenen: das erfordert eine hohe Eigenständigkeit aller drei Ebenen (sogar aller vier Ebenen, wenn man in den Begriff der Amtskirche auch das Amt aller Getauft miteinbezieht). Nicht nur die Bischöfe und Pfarrer, sondern auch die Gläubigen können von einer Hierarchie, in der jeweils ein Leiter für mehr als 1000 Untergeordnete zuständig ist, keine detaillierten Anweisungen erwarten. Papst, Bischöfe und Pfarrer sind wesentlich zum Vertrauen in die Eigenverantwortlichkeit der jeweils unteren Ebenen hingeordnet; das Wesen der Kirche mit ihrer flachen Hierarchie ist die Demut der leitenden Ämter und das Vertrauen in die eigene Verantwortlichkeit. Tatsächlich setzen sowohl der Papst den Bischöfen, die Bischöfe den Pfarrern als auch die Pfarrer ihren Gemeindemitgliedern zwar Grenzen; im Gegensatz dazu ist aber die Freiheit der Empfänger in den anderen Fragen nicht nur systembedingt, sondern theologisch wesensnotwendig.
Die Kirche fördert durch die unverändert flache Hierarchie die Eigenständigkeit (Subsidiarität) und Selbstverantwortung (Personalität) aller Mitglieder der Kirche.
Nach diesen ausführlichen theologischen Grundlegungen, die dennoch nur skizzenhaft geblieben sind, möchten ich nun kurz auf Akzentverschiebungen in der heutigen Wahrnehmung von Kirche, Gemeinde und Amt eingehen - vor allem, um Korrekturbedarf anzuzeigen.
a. Jedes Handeln eines Getauften ist kirchliches Tun. - Für viele ist das Handeln von Papst und Bischöfen, wie es in den Medien vermittelt wird, bedeutsamer als die Bemühung des christlichen Nachbarn. Viele kehren der Kirche den Rücken, weil sie mit dem Fehlverhalten einzelner Amtsträger nicht einverstanden sind, obwohl sie im persönlichen Umgang mit anderen Christen eher positive Erfahrungen machen.
Wichtig ist, dass wir wieder eine Kultur in unseren Gemeinden leben, in der die Tugend der einzelnen Gemeindemitglieder wesentlicheres Zeugnis für Christus ist, als die Untugenden ihrer Repräsentanten. Das erfordert ein Umdenken auf allen Ebenen und in allen Gremien der Kirche.
b. Die Hierarchie ist auf den sensus fidelium angewiesen. - Lehre & Dogmen, Papst & Konzilien, Bischöfe & Priester werden oft eher als Hort der Unfreiheit, der Einschränkung und der Bevormundung verstanden. Dabei haben sie als hierarchische Aufgabe, die Freiheit der Getauften zu sichern und in einen weiten Rahmen zu stellen. Wie genau die Getauften ihrer Berufung in diesem Rahmen nachkommen, wie sie ihre Elternschaft (ihren Auftrag zur Lehre, zur Mediengestaltung, zur tätigen Nächstenliebe, als Politiker oder als Dienstleistender) gestalten, ist ihre Freiheit. Der Geist Gottes wirkt in der Ausgestaltung dieser Freiheit, in der Berufung der Laien und in der Wahrnehmung ihrer Verantwortung für die Welt. Erst durch die Wahrnehmung dieser Freiheit im Geiste Gottes vollzieht sich Kirche; auf dieses Tun ist z.B. die Unfehlbarkeit des Papstes bezogen, der seine (materiale) Unfehlbarkeit durch das Schauen auf das Wirken des Geistes in den Getauften erhält.
Dieses wieder neu ins Bewusstsein der Kirche zu heben, ist nicht nur eine Aufgabe der Hierarchie, die sich selbst beschränkt. Es ist auch eine Aufgabe der Laien, mutig größere Verantwortung zu übernehmen.
c. Die Unfehlbarkeit ist Garant der Toleranz in der Kirche. - Die (formale) Unfehlbarkeit des Papstes wird als dem Wesen der Toleranz entgegengesetzt angesehen: Anscheinend maßt sich hier einer ein Urteil über alle an. Tatsächlich kommt die Unfehlbarkeit des Papstes einem Unfehlbarkeitsverbot gleich: Kein Katholik darf sich anmaßen, über die Katholizität eines anderen zu urteilen oder ihn gar der Kirche zu verweisen. In Gemeinden, Gruppen und Bewegungen geht viel Glaubensenergie und Leben verloren, wenn man sich gegenseitig verdächtigt und des Fundamentalismus oder Liberalismus bezichtigt.
Wir müssen auf allen Ebenen der Kirche - aber auch in den Pfarrgemeinden - wieder die schwierige Tugend der christlichen Toleranz einüben. Toleranz heißt nämlich nicht, alles gutzuheißen, was existiert. Toleranz heißt vielmehr, auch das zu erdulden und ertragen (und gelegentlich sogar mitzutragen!), was nicht meines ist.
a. Ortskirche ist das Bistum, nicht die Pfarrgemeinde: Vernetzung tut Not. - Nicht die Pfarrgemeinde ist die theologisch und kirchenrechtlich bedeutsame Ortskirche, sondern das Bistum. Innerhalb einer Pfarrei darf es daher auch Leerstellen geben, die durch andere Gemeinden gefüllt werden. Ein Konkurrenzdenken (z.B. beim Kirchenbesuch, der medialen Präsenz oder Kollektenaufkommen) ist daher zu vermeiden. Umgekehrt ergibt sich daraus die Verpflichtung, das »Kirchturmdenken« abzulegen und über die Pfarrgrenzen hinaus zusammenzuarbeiten.
b. Wesentliches geschieht im Verborgenen: Des Einzelnen, der Familien, der Gemeinde. - Frustration verbindet sich mit dem sichtbaren Abnehmen von Teilnehmerzahlen z.B. in den Gottesdiensten, den Gemeindeveranstaltungen (z.B. den Pfarrwallfahrten) oder im Engagement in den Vereinen. So wichtig diese Einrichtungen auch sind: Für Gott zählt das Herz eines jeden Menschen. Das, was im Herzen ist, ist allerdings zunächst unsichtbar. Die Verwirklichung von Gebet und Gottesbeziehung in Gemeinde und Gemeinschaft ist unverzichtbar, denn ein Vernachlässigen des Glaubenslebens führt über kurz oder lang auch zum Verschwinden des Glaubens. Deshalb ist zu vermeiden, mangelndes Gemeindeleben mit mangelndem Glauben gleichzusetzen!
»Lehrer und Priester werden fürs Bemühen bezahlt - nicht fürs Erreichen.« Weder die Priester noch die Laien stellen etwas her oder produzieren etwas. Unsere Aufgabe ist es nicht, möglichst viele Menschen in die Kirche zu locken, die Gottesdienste zu füllen und die Kirchenkassen nebenbei auch. Unsere Aufgabe ist es nicht, Gemeindestrukturen am Leben zu erhalten - sondern denen zu Diensten zu sein, die glauben und ihren Glauben leben möchten. Das muss nicht immer gleichbedeutend mit der Erhaltung von kirchlichen Strukturen sein.
c. Ein Warten auf das Amtstun korrespondiert mit einer Amtsüberzeichnung. - Nicht wenige Gemeindemitglieder glauben, »die Kirche« kümmere sich erst um sie, wenn der Pfarrer es persönlich getan hat. Dieses Missverständnis hat sich auch dort erhalten, wo mittlerweile der Pfarreirat diese Aufgaben übernommen hat. Das Bewusstsein dafür zu wecken, das jegliches Tun von Christen (z.B. Besuch der Kranken durch die Angehörigen, Hilfe den Bedürftigen durch die Nachbarn, Flüchtlingsarbeit durch Freiwillige, Einsatz für die Umwelt oder in der Politik) ein Tun der Kirche ist, wird zuweilen aber auch dadurch erschwert, dass manche Priester oder Pfarrmitglieder ihr Amt in diesem Sinne überzeichnen.
Es gilt (1) Initiativen der Gemeindemitglieder (selbst derjenigen, die sich nicht ausdrücklich im Namen der Gemeinde engagieren) als den Normalfall des kirchlichen Handelns darzustellen; sie (2) zu würdigen und von allen Seiten zu unterstützen und (3) jede Haltung zu vermeiden, dass kirchliches Tun immer eines offiziellen Auftrags oder eine amtlichen Legitimation bedarf. Die Taufe ist Legitimation genug.
a. Die Sakramente sind Gottesbegegnungen, die Quelle des Glaubens sind. - Der Empfang der Sakramente - sowohl der Eucharistie in ihrer normalen Gestalt, als auch der Taufe, der Eucharistie und Firmung als Initiation - sind Voraussetzung für ein Leben aus der Gnade. Sie setzen also kein besonders tugendhaftes oder glaubensintensives Leben voraus, sondern sollen dieses ermöglichen. Hürden für die Zulassung zu den Sakramenten der Eucharistie und der Firmung sind möglichst niedrig anzusetzen.
Die Eucharistiekatechese soll einen Zugang des Kindes zur Gemeindeliturgie und einem regelmäßigen Empfang der Kommunion als Ziel haben. Dennoch sollten die Gemeinden bestrebt sein, der Zulassung zur Teilnahme an der Erstkommunionkatechese keine territorialen oder sonstigen Grenzen zu setzen, die nicht dem Empfang des Sakramentes selbst entgegengesetzt sind.
Eine Firmkatechese sollte in einem Alter angeboten werden, in dem die Kinder/Jugendlichen noch offen für eine Gottesbegegnung sind - und nicht so spät, dass die Firmgnade nur denen geschenkt wird, die bereits ein ausgeprägte Glaubensleben auch in und nach der Pubertät entwickelt haben.
b. Die Sakramente (vor allem die Eucharistie) sind Höhepunkt des Glaubens. - Das II. Vatikanische Konzil hält in seiner Beschreibung der Eucharistie fest, das sie nicht nur Quelle des Glaubens, sondern auch deren Höhepunkt sei. Eine Banalisierung des Gottesdienstes zur Erlangung größerer Besucherzahlen oder eine Erhöhung der Attraktivität, die zu Lasten der Sakralität geht, ist daher abzulehnen. Wir bemühen uns als ganze Gemeinde, die Gottesdienste (vor allem die Sonntage und darüberhinaus die Fest- und Feiertage) besonders festlich und ansprechend zu gestalten. Vor allem legen wir Wert auf den Einsatz von Musik und Gesang, eine würdige Gestaltung des Gottesdienstraumes, der liturgischen Geräte und Gewänder und einer lebendigen Mitwirkung von Messdienern, Kantoren und Lektoren.
c. Niederschwellige Gottesdienste außerhalb der Eucharistiefeier. - Eine wunderbare Verbindung von niederschwelligen Gottesdienstangeboten bei gleichzeitiger liebevoller Vorbereitung und intensiver Gestaltung sind z.B. die Gottesdienste der Kinderkirche, Taizegottesdienste, Gottesdienste der geistlichen Gemeinschaften und Gebetskreise. Gefördert werden sollen darüberhinaus alle nicht-eucharistischen Gottesdienstformen, die von Gruppen, Familien, Vereinen oder Gemeinschaften gepflegt werden - wie z.B. Rosenkranzgebet, Mai- und Kreuzwegandachten, Gebetsstunden an Gründonnerstag oder zum 40-stündigen und Ewigen Gebet.
Die Kirche soll weiterhin tagsüber geöffnet bleiben. Ermuntert werden sollen auch die Gemeindemitglieder, Besuche in der Kirche außerhalb der Gottesdienstzeiten zum privaten Gebet zu nutzen.
Aus dem theologischen Grundlagen ergibt sich eine umgekehrte Hierarchie: Das päpstliche Lehramt dient der Einheit der Bischöfe; die Bischöfe dienen den Gemeinden, in den Gemeinden dienen die Priester den Gläubigen und die Getauften versehen ihren Dienst an der Welt. Subsidiarität bedeutet, dass jeder nach Möglichkeit nur das tut, was ihm auch zukommt: Der Dienst der Gläubigen an der Welt kann nicht durch priesterliches Tun ersetzt werden, ebensowenig der Dienst des Priesters durch bischöfliche Kommissionen - etc. Die Umsetzung der Subsidiarität erfordert vor allem eine Wertschätzung der jeweils anderen Dienste und eine beherzte Wahrnehmung der eigenen Verantwortung.
a. Wahrnehmen, auch wenn etwas im Verborgenen geschieht. - Eine lebendige Gemeinde ist auch dort zu finden, wo zwar im Verborgenen gebetet wird, die Gemeinde sich unauffällig gegenseitig zur Seite steht und offenherzig auch denen hilft, die nicht zu ihr gehören. â Die Lebendigkeit einer Gemeinde misst sich nicht an der Anzahl der Gottesdienstbesucher, der Wahlbeteiligung bei Pfarreiratswahlen oder der Größe der kirchlichen Verbände.
b. Wertschätzen, was geschieht - Hilfe anbieten, ohne zu entpflichten. - Subsidiarität bedeutet für die nächsthöhere Ebene (oder, um im Bild der umgekehrten Hierarchie zu bleiben: Der nächstniederen Ebene) Hilfe anzubieten, ohne zu entpflichten. Der Pfarrer (und mit ihm Seelsorger und die Leitungsgremien) ist dazu aufgerufen, den Gemeindemitgliedern zu ihrem Dienst Mut zu machen, sie zu stärken und zu stützen, ohne ihre Aufgaben einfach zu übernehmen und somit die Eigenständigkeit des Laienapostolats aufzuheben. Gleiches gilt (mutatis mutantur) für die Bistumsebene und die Weltkirche.
c. Ergänzen, korrigieren, weiterführen. - Subsidiarität konkretisiert sich also in der Ergänzung (z.B. durch finanzielle, personelle und räumliche Hilfen), aber auch in der Entlastung von falschen, entgrenzten Verpflichtungsdenken. Gelegentlich kann auch eine vorsichtige Anregung zur kreativen Neuausrichtung sinnvoll sein.
a. Förderung vom persönlichen Gebetsleben. - Allen kirchlichen Vollzügen (in Martyria, Leiturgia und Diakonia) zugrunde liegen sollte das persönliche Gebet, in dem sich die lebendigen Christusbeziehung verwirklicht. Dieses ist für jeden unsichtbar (nur der Vater allein weiß davon - Mt 6, 6); somit entzieht sich die Grundlage des persönlichen Christseins einer jeden Bemessung, Beurteilung oder Quantifizierung. Das erfordert einen grundsätzlich toleranten, wohlwollenden und wertschätzenden Umgang aller Christen miteinander.
Alles gemeindliche Tun bemisst sich dennoch von der Frage her, inwieweit es das persönliche Gebetsleben eines jeden Christen fördert und dadurch die Christusbeziehung lebendig sein lässt.
b. Katechese, die Glauben festigt. - Jede Gemeinde ist dazu aufgerufen, über die Sakramentenkatechese zur Erstkommunion und Firmung hinaus katechetisch zu wirken. So wird sie ihren Glauben und damit Gott, die Kirche und die Menschen besser kennenlernen, um sie zu verstehen und lieben zu lernen.
c. Liturgie, die mystagogisch ist. - Die Liturgie soll reichhaltig sein und somit ein mystagogischer Zugang (ein Zugang, der sich vor allem durch das Mitfeiern erschließt) für alle Menschen, die auf dem Weg zu Gott sind. Vor allem der mystagogische Ansatz gewährleistet eine ansprechende Liturgie sowohl für Fernstehende und »Feiertagschristen«, als auch für regelmäßige Beter.
Die Liturgie soll daher weder eindimensional sein (auch Kindergottesdienste dürfen geheimnisvoll bleiben!) oder ausschließlich auf ein bestimmtes Klientel ausgerichtet werden. Jeder Gottesdienst ist immer auch Gemeindegottesdienst.
a. Gott ruft, bekehrt und schenkt Glauben - Keine Machermentalität entwickeln. - Jeder - ob Getaufter, Hauptamtlicher oder Geweihter - ist im Hinblick auf den Glaubensweg für andere immer nur Wegbereiter. Das entlastet von der Verpflichtung, den Glauben anderer »machen zu müssen«; das verpflichtet aber auch dazu, sich selber auf den Weg zu begeben und Begleiter anderer zu sein.
b. Nur betende Menschen werden zur Quelle für sich und andere. - Um für andere Quelle zu sein, darf keiner seine eigene Spiritualität vernachlässigen. Eine gute Gemeinde eröffnet Räume der Stille, der Erholung und des Zur-Ruhe-Kommens. Was personell nicht machbar ist, bleibt dann für eine gewisse Zeit einfach ungetan: Wir wollen den Menschen eine Oase sein und sie nicht vom Trinken abhalten.
c. Hindernisse ausräumen: Katechetische Predigten und Glaubensweitergabe in Familien. - Auch, wenn Gott den Glauben schenkt und er kein Produkt unserer Pläne und Konzepte ist, so sind wir doch dazu aufgerufen, Glaubenshürden und Hindernisse auszuräumen. Das kann durch offizielle Veranstaltungen (in Predigten, Vorträgen, Glaubensgesprächskreisen oder Kursen) stattfinden, wichtiger aber ist die Weitergabe des Glaubens in den Familien. Dort werden nicht nur Grundlagen gelegt, sondern durch persönliches Beispiel und stellvertretenden Gebet die wichtigsten Hemmnisse genommen.
