Neue Site - empfehlenswert! Ein Ableger der Karl-Leisner-Jugend: aktueller, kürzer, frischer und moderner: www.gut-katholisch.de.
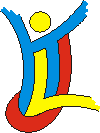 |
KARL-LEISNER-JUGEND |
Eine kleine Metaethik: Gibt es Gut und Böse?
|
Man nennt in der metaethischen Diskussion die Position, die die Wahrheitsfähigkeit moralischer Urteile bestreitet, die skeptische. Natürlich gibt es auch viele moralische Aussagen, die nicht umstritten sind. Auch die Skeptiker sind z. B. der Meinung, dass man nicht jeden beliebigen Menschen töten darf. Sie legen oft viel Wert auf die Feststellung, dass ihre Anschauung keine unmoralischen Konsequenzen habe. Doch da sie keine objektiven Normen anerkennen, sind wir neugierig, welche Gründe sie für das Tötungsverbot anführen.
Zwei dieser Gründe will ich vorstellen. Der eine Grund lautet: Wir alle haben ein Interesse an einer friedlichen, funktionierenden Gesellschaft, in der nicht Mord und Totschlag herrschen. Frei herumlaufende Mörder sind eine unangenehme Sache. Deshalb befürworten wir eine Gesellschaft, die Mord als böse ächtet, und einen Staat, der das Mordverbot durchsetzt, und nehmen dafür gerne in Kauf, dass auch wir selber uns an das Verbot halten müssen.
Der andere Grund liegt auf einer anderen Ebene und trägt dem Umstand Rechnung, dass wir Mord als böse empfinden. Die meisten von uns hätten wohl, wenn sie sich aus irgendeinem Grund zu einer solchen Tat hinreißen ließen, danach ein ziemlich schlechtes Gewissen. Das hat nach dieser Auffassung seinen Grund in unseren Genen. Die Evolution hat uns im Interesse der Arterhaltung (oder â nach Dawkins â im Interesse unserer Gene) mit einer instinktiven Tötungshemmung ausgestattet. Moralische Vorstellungen und Empfindungen sind ein Trick der Evolution, um uns zu kooperativem Verhalten zu verführen.
Die Gegenposition zum Skeptizismus ist der moralische Realismus. Dieser sagt: Moralische Urteile sind sehr wohl wahrheitsfähig. Die Urteile: »Die Rettung eines Menschenlebens ist gut« und »Mord ist böse« sind wahr aus dem einfachen Grund, weil Lebensrettung wirklich moralisch gut und Mord wirklich moralisch verwerflich ist. Werte sind reale Eigenschaften dieser Handlungen. Das Problem ist, dass wir diese Werte mit unseren Augen nicht sehen, mit unseren Händen nicht betasten und mit keinerlei Messinstrumenten untersuchen können. Selbst mit den ausgeklügeltsten Methoden der Naturwissenschaft sind sie nicht dingfest zu machen. Wer sich, um zu wissen, wie es um die Welt als Ganzes bestellt ist, allein auf die Naturwissenschaften verlässt, wird deshalb dazu neigen, moralische Werte für reine Ideen, Fiktionen oder Projektionen, jedenfalls nicht für etwas Reales zu halten. Man nennt die philosophische Richtung, die nur das gelten lässt, was sich naturwissenschaftlich überprüfen lässt, Naturalismus.
Es war George Edward Moore, der als moralischer Realist sich nicht scheute, aus dieser Eigenart des moralischen Wertes die Konsequenz zu ziehen und von einer nicht-natürlichen Eigenschaft zu sprechen. Das tat er in seinem Werk »Principia Ethica«, das 1903 erschien und die ganze, bis heute andauernde metaethische Diskussion in der Philosophie lostrat. Die Rede von der nicht-natürlichen Eigenschaft war natürlich unglücklich und lieferte eine willkommene Steilvorlage, moralische Werte in den Verdacht des Exotischen und Absonderlichen zu rücken.
Die Leugnung der Moral verändert das Menschenbild: Wenn Werturteile nur Empfindungen oder purer Eigennutz sind, bedeutet dies eine Beschneidung der menschlichen Vernunft.
In den ersten Jahrzehnten nach Moore gab es im Wesentlichen zwei Methoden, die Realität des Guten loszuwerden. Es sind dies die beiden philosophischen Richtungen des Emotivismus und des Präskriptivismus.
Der Emotivismus ist vor allem mit den Namen Alfred Jules Ayer (1910-1989) und Charles Leslie Stevenson (1908-1979) verknüpft. Gemäß dieser, in den 30er Jahren entwickelten Theorie drücken Werturteile nur Gefühle oder Einstellungen aus, im Wesentlichen solche der Billigung oder Missbilligung. Das Urteil »Mord ist böse« ist folglich so wenig wahrheitsfähig wie das Rümpfen der Nase über eine Speise, die ich nicht mag. »Wenn ich daher zu jemandem sage âDu tatest Unrecht, als du das Geld stahlstâ, dann sage ich nicht mehr aus, als ob ich einfach gesagt hätte âDu stahlst das Geldâ. Indem ich hinzufüge, dass diese Handlung unrecht war, mache ich über sie keine weitere Aussage. Ich zeige damit nur meine moralische Missbilligung dieser Handlung. Es ist so, als ob ich âDu stahlst das Geldâ in einem besonderen Tonfall des Entsetzens gesagt oder unter Hinzufügung einiger besonderer Ausrufezeichen geschrieben hätte», schreibt Ayer in seinem Buch »Sprache, Wahrheit und Logik«.
Stevenson, und außer ihm auch Rudolf Carnap, stellen noch eine weitere Funktion moralischer Urteile heraus: nämlich Gefühle nicht nur auszudrücken, sondern im Hörer hervorzurufen. Werturteile dienen also der Beeinflussung, nach Stevenson noch dazu auf suggestive Weise, weil sie durch die Konzentration auf das Objekt, über das sie angeblich etwas aussagen, von der eigenen Einstellung ablenken, die der Sprecher in Wirklichkeit übermitteln will. Damit stellte Stevenson die Moral unter den Generalverdacht, ein fragwürdiges Instrument der Beeinflussung und Machtausübung zu sein. Dabei übersah er, dass seine Behauptung, moralische Urteile dienten der Beeinflussung, gar nicht für Urteile als solche gelten, sondern nur für die entsprechenden Sprechakte. Urteile sind in erster Linie Denkakte und kommen auch außerhalb zwischenmenschlicher Kommunikation vor, z.B. wenn ich mir selber die Frage stelle, wie ich mich in dieser oder jener Situation unter moralischem Gesichtspunkt verhalten soll, z.B.: »Darf ich lügen und betrügen, um in meiner Karriere voranzukommen?« Nur wer so gewissenlos ist, dass er sich niemals solche Fragen stellt, oder wer vergessen hat, dass er sich solche Fragen schon einmal gestellt hat, kann auf die Idee kommen, moralische Urteile dienten vor allem der Beeinflussung anderer. Wer ein Gewissen hat, dem geht es darum, das Richtige zu tun, weil es das Richtige ist. Moralität ist gerade der Gegenpol zu skrupelloser Machtausübung.
Im Emotivismus sind Werturteile lediglich Ausdruck von Gefühlen oder Einstellungen. Moral ist somit nicht mehr als das Rümpfen der Nase über eine Speise, die man nicht mag, und dient der Beeinflussung anderer.
Ausgefeilter als diese etwas plumpe Form der Moralnegation ist der Präskriptivismus. Er wurde von R. M. Hare (1919-2002) ca. fünfzehn Jahre später entwickelt. Für ihn ist das Typische des Werturteils das Befehlen oder Empfehlen. Wenn ich sage: »Dieser Pudding ist gut« oder »Diese Handlung ist gut«, dann empfehle ich den Pudding oder die Handlung. Natürlich kann ein solches Urteil auch ein deskriptives Element enthalten. Wenn ich weiß, dass mein Gegenüber süßen Pudding mag, dann enthält die Aussage »Dieser Pudding ist gut« zugleich auch die Information, dass er süß ist. Ein anderer dagegen mag ihn vielleicht weniger süß. Wenn ich diesem einen Pudding mit dem Urteil »Dieser Pudding ist gut« empfehle, beschreibt der deskriptive Teil des Urteils einen anderen Sachverhalt, nämlich den, dass der Pudding nicht besonders süß ist. Ich benutze also dasselbe Wort »gut«, obwohl die deskriptive Bedeutung verschieden ist. Wenn ich sage: »Das ist ein gutes Messer«, dann hat »gut« z.B. die Bedeutung von »scharf«; wenn ich aber sage: »Das ist ein gutes Rennpferd«, will ich damit nicht sagen, dass das Pferd scharf sei, sondern schnell. Die deskriptive Bedeutung des Wortes »gut« ist also vollständig kontextabhängig. Die einzige Gemeinsamkeit in seinem Gebrauch liegt in seiner Funktion des Empfehlens. Im Unterschied zu einer deskriptiven Aussage aber ist das Empfehlen nicht wahrheitsfähig.
Das klingt doch sehr überzeugend, nicht wahr? Wo liegt der Fehler? Stellen wir statt des Messers und des Rennpferdes folgende Urteile gegenüber: »A ist ein guter Mensch« und »B ist ein guter Giftmörder«. Sofort springt ins Auge, dass sich hier die Bedeutungsverschiedenheit des Wortes »gut« nicht nur auf die deskriptive Bedeutung beschränkt. Zusätzlich ist auch eine ganz andere Art der Wertung im Spiel. Wenn ich über A sage, er sei ein guter Giftmörder, dann benutze ich das Wort »gut« im rein instrumentellen Sinn: Er versteht zwar sein Handwerk, aber dieses Handwerk, das Morden, verurteile ich gleichzeitig im moralischen Sinne. Wenn ich dagegen sage, B sei ein guter Mensch, dann meine ich eine in sich lobenswerte Eigenschaft, einen in sich wertvollen Charakter.
Jetzt erkennen wir im Rückblick, dass in den Beispielen vom Messer und vom Rennpferd das Wort »gut« lediglich die Zweckmäßigkeit bezeichnete. Ein Messer ist zum Schneiden da. Ein gutes Messer ist ein solches, das seinen Zweck gut erfüllt, und dazu muss es scharf sein. Seine »Güte« ist die eines Mittels zum Zweck, also seine Nützlichkeit. Analog verhält es sich mit dem Rennpferd und seiner Schnelligkeit. Wenn wir dagegen von einem guten Menschen sprechen, dann meinen wir nicht seine Nützlichkeit für irgendeinen Zweck außerhalb von ihm. Die moralische Güte ist nicht Mittel zum Zweck, sondern selber Zweck. Sie ist, wie der hl. Anselm sagt, die Rechtheit des Willens, die um ihrer selbst willen erstrebt und bewahrt wird. Der Vergleich des guten Menschen mit dem guten Giftmörder stammt nicht von mir, sondern von Hare, und er war tatsächlich der Meinung, dass der Unterschied zwischen beiden Werturteilen lediglich die deskriptive Bedeutung betreffe: eine abstruse, aber konsequente Folgerung seines Ansatzes.
Es war dann John Leslie Mackie (1917-1981), der 1977 die Dominanz dieser philosophischen Richtung beendete und sie durch seine Irrtumstheorie ersetzte. Er durchschaute das semantische Missverständnis, dem Emotivismus und Präskriptivismus erliegen, nahm moralische Aussagen in ihrem Anspruch wieder ernst und sagte, dass wir tatsächlich reale Eigenschaft meinen, wenn wir von moralischen Werten sprechen. Der einzige Haken bei der Sache war für ihn nur: Diese Werte gibt es nicht. Moralische Urteile sind also nicht wahrheitsunfähig, sondern falsch. Das, was wir meinen, gibt es nicht. Wir irren uns.
Sein Buch »Ethics« trägt den bezeichnenden Untertitel »Inventing Right and Wrong«. Nach der Lektüre ist man allerdings enttäuscht: Trotz seines Anspruchs hat er keinen einzigen Wert, kein einziges moralische Prinzip neu erfunden, sondern lediglich bereits bekannte moralische Systeme miteinander kombiniert. Allein das ist schon ein Hinweis, dass Werte etwas Vorgegebenes und nicht etwas von uns Erfundenes sind. Vor allem aber beachtet Mackie nicht den uns allen vertrauten Umstand, dass Werte Gegenstand moralischer Erfahrung sind. Wenn ich Zeuge einer heroischen Selbstverleugnung werde, dann ist meine Ergriffenheit die Reaktion auf die moralische Qualität, die mir dabei vielleicht so klar wie noch nie zuvor aufgegangen ist. Die Entrüstung über ein niederträchtiges Verbrechen ist die Antwort auf eine Erkenntnis: Mir ist die Verabscheuungswürdigkeit des Bösen bewusst geworden. Oder nehmen wir eine Situation, wo ich selber betroffen bin, in der sich z.B. Pflicht und Interesse widersprechen. Ich muss mich entscheiden, und in dieser Entscheidung sehe ich mich dem unbedingten Anspruch des Guten ausgesetzt. Dieser Anspruch ist nicht das Ergebnis meiner Entscheidung oder meiner Einstellung, sondern genau umgekehrt: Ich erfahre ihn als etwas mir Vorgegebenes, das mich bindet, ob ich will oder nicht. Ich verzichte auf den Mord nicht deshalb, weil das für mich vorteilhaft ist, sondern aus Achtung vor der Würde und dem Lebensrecht des Nächsten, das mir ein solches Tun verbietet. Wenn ich dieses Recht einsehe und anerkenne, handle ich aus sittlicher Einsicht statt blindem Interesse. Kant spricht vom kategorischen Imperativ als einem Faktum der Vernunft.
Wenn Horkheimer und Adorno in ihrem berühmten Diktum von der Unmöglichkeit schreiben, aus der Vernunft ein grundsätzliches Argument gegen Mord vorzubringen, dann haben sie Recht, wenn in dem verwendeten Begriff die Vernunft auf die instrumentelle Vernunft reduziert ist, also auf jene Vernunft, die sich darauf beschränkt, Nützlichkeit und Funktionalität zu erkennen. Diese Vernunft bleibt tatsächlich das, als was David Hume, der empiristische Vorläufer des Emotivismus, die Vernunft überhaupt angesehen hat: eine Sklavin der Leidenschaften. Dem Menschen werden die Handlungsziele durch seine naturhaften Triebe vorgegeben. Er kann mit, aber nicht aus Vernunft handeln. Der Vernunft bleibt in moralskeptischer Perspektive nur die Beurteilung der Handlungen nach ihrer Zweckmäßigkeit zur Erreichung jener Ziele. Sie steht im Dienst der vitalen Egozentrik.
Ganz anders im moralischen Realismus. Durch den mir begegnenden Anspruch des Guten, der etwa vom Lebensrecht des Anderen ausgeht, werde ich aus meiner Egozentrik herausgerissen. Denn indem ich diesen Anspruch anerkenne, höre ich auf, naiver Mittelpunkt meiner eigenen Welt zu sein, die ich nur unter dem Gesichtspunkt meiner vitalen Interessen betrachte. Die moralische Vernunft befähigt mich, diesen »Blick von nirgendwo« (Thomas Nagel) einzunehmen und Verantwortung zu übernehmen. Gerade dadurch unterscheide ich mich vom Tier, das Gefangener seines Selbsterhaltungstriebes bleibt.
Spaemann benutzt in diesem Zusammenhang das schöne Wort vom »Erwachen zur Vernunft«. Er rehabilitiert damit einen ethischen Vernunftbegriff, der die Wahrheitsfähigkeit der Moral impliziert. Der Mensch ist dank seiner Vernunft zur Erkenntnis von gut und böse fähig.
Hier erkennen wir, wie sich in der metaethischen Diskussion entlang der Linie von Realismus und Skeptizismus auch das Menschenbild entscheidet. Der Leugnung der Moral entspricht die Vernunftamputation des Menschen.
