Neue Site - empfehlenswert! Ein Ableger der Karl-Leisner-Jugend: aktueller, kürzer, frischer und moderner: www.gut-katholisch.de.
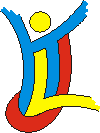 |
KARL-LEISNER-JUGEND |
Die christliche Vorstellung vom Staat-Kirche-Verhältnis
|
Dass Staat und Religion grundsätzlich getrennt werden sollten, ist keine religiöse Selbstverständlichkeit. Im Gegenteil: Den meisten Religionen ist dieser Gedanke fremd. Noch im römischen Reich beanspruchte der Kaiser gelegentlich einen gott-gleichen Status und bis heute findet sich die grundsätzliche Einheit der zwei Pole immer noch im Islam fest verankert â und auch in vielen anderen Religionen. Der Gedanke, dass Religion und Staat zu unterscheiden und getrennt zu betrachten sind, kam allerdings nicht erst mit der Aufklärung (wie manche meinen), sondern bereits mit dem Christentum.
So ist â nicht erst seit Augustinus' »Der Gottesstaat« (De Civitas Dei) aus dem frühen Jahren 413-426 n. Chr. â eine Unterscheidung von Staat und Kirche Teil der christlichen Überzeugung. Schon Jesus selbst hat den Grund für die Unterscheidung gelegt (z. B. in Matthäus 22,21: »Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist!« oder Johannes 18,36: »Mein Reich nicht von dieser Welt«), und so war bereits den ersten Christen klar, dass es nicht die Aufgabe der Kirche ist, die Leitung eines irdischen Reiches zu erlangen. (Erst im späteren oströmischen Reich wurde die Trennung wieder abgemildert; diese erneute Vermischung von Staat und Kirche finden wir heute noch in manchen orthodoxen Kirchen.) Nach Augustinus stehen Welt und Kirche sogar in einem unlösbaren, ständigen, aber auch fruchtbaren Gegensatz. Sowohl der Staat als auch die Kirche tragen Sorge um das Wohl der Menschen und stützen sich gegenseitig; dennoch sind staatliches Tun und kirchliches Handeln sehr wohl zu unterscheiden.
Durch diese revolutionäre Idee des Christentums wird verhindert, dass der Staat für seine Ideen religiösen Gehorsam verlangt und sich selbst an die Stelle Gottes oder eines Erlösers setzt; gleichzeitig wird aber auch mit Beauftragung des Staates als weltliche Ordnungsmacht möglich, die Freiheit der Religionsausübung (die libertas ecclesiae) zu garantieren und zu verhindern, dass die Kirche das Wirken zum Heil der Menschen mit politischem Einsatz verwechselt.
Der Grundsatz der »Unterscheidung von Staat und Kirche« ist bereits im Wesen des Christentums angelegt und keineswegs eine Frucht der Aufklärung, die der Kirche mit Gewalt abgetrotzt werden musste. Erst die »Trennung von Staat und Kirche« und die Vermeidung, weltlicher Machthaber und kirchlicher Amtsträger in einer Person zu sein, musste zum Teil gegen den Widerstand von Fürstbischöfen und Gottkönigen durchgesetzt werden.
Dass der Islam eine solche Trennung nicht kennt, liegt also nicht an der verpassten Aufklärung â vielmehr lässt die religiös verankerte Einheit von politischer und religiöser Macht keine solche Aufklärung zu: Im Islam setzt der Staat Glaubensvorschriften direkt mit weltlicher Autorität durch. Das Christentum dagegen erlässt keine eigene staatliche Gesetze, sondern bildet christliche Politiker, die dann mit eigenem Erkennen (von Religion, Wissenschaft, Geschichte, Rechtswesen etc.) politisch handeln.
Grundsätzlich gilt: Das Christentum ist vom Wesen her aufgeklärt. Das heißt, es beruft sich in der Ordnung der weltlichen Angelegenheiten nicht unmittelbar auf Gottes Anweisungen. Vielmehr ist alles, was zur Staatsführung nötig ist, auch durch Vernunft, Erkennen, Wissen und Gewissen erkennbar. Die Religion bestärkt die natürliche Erkenntnis des Menschen und weitet sie; im Gegensatz zu fundamentalistischen Religionen sieht die Kirche in der Offenbarung kein Gegensatz zum Erkennen durch die Vernunft.
Fazit: Eine Verschmelzung von Staat und Kirche ist dem Christentum von Anfang an zuwider; die Kirche selbst hat immer großen Wert darauf gelegt, nicht mit einer staatlichen Macht verwechselt zu werden. Die faktische Trennung hat sich allerdings in der Geschichte des Christentums oft als sehr mühsam erwiesen.
Nun gibt es innerhalb der Gesellschaft, die vom Staat geordnet wird, Menschen, die Anhänger einer Religion sind. Die Aufgabe des Staates ist, diese Freiheit zu schützen: Religionsfreiheit zu ermöglichen.
Die Aufgabe des Staates ist es natürlich nicht, den Menschen vorzuschreiben, welche Religion sie haben sollen. Das ist in der langen Geschichte der Staaten oft nicht so gehandhabt worden; um des vermeintlichen Friedens willen wurde von Staatsoberhäuptern auch eine einheitliche Religion vorgeschrieben. Die Vermutung jedoch, der Gedanke der Religionsfreiheit sei grundsätzlich ein Gedanke der modernen Gesellschaft, ist nicht richtig: Bereits im römischen Reich gab es immer wieder Phasen großer Religionsfreiheit, ebenso auch in mittelalterlichen Städten, in denen es oft sehr liberal zuging. Umgekehrt haben säkulare Staaten oft die Freiheiten der Religionen erbittert bekämpft (so auch noch in heutiger Zeit â zum Beispiel in Nordkorea). Aber auch in Zeiten der religiösen Freiheit blieb religiöse Toleranz instabil, wenn sie nicht vom Staat geschützt wurde: Schon kleine Anlässe genügten für gewaltsame Volkserhebungen (Pogrome z. B. gegen die Juden) oder unter religiösem Vorwand geführten Kriege (30-jähriger Krieg).
Der heutige Staat verhält sich zwar den einzelnen Religionen und Konfessionen gegenüber neutral; die Religionsausübung als solche jedoch muss auch staatlich gewährleistet werden. Dazu gehört nicht nur die Erlaubnis, Glocken zu läuten und Kirchen zu errichten; zum Schutz der Religionsausübung können auch Feiertage eingerichtet werden und sogar durch Arbeitsverbote geschützt werden. So erklären sich auch die öffentlichen Verbote von Tanzveranstaltungen an «stillen Feiertagen» wie z. B. dem Karfreitag, dem Allerseelentag und dem Volkstrauertag.
Manche meinen, damit hätte der Staat seine Kompetenz überschritten und er verlange von nicht-religiösen Bürgern eine religiöse Haltung. Richtig ist, dass er von allen Bürgern Toleranz und Rücksicht denen gegenüber erwartet, die eine Religion ausüben wollen. Zu einer religiösen Handlung wird durch den Schutz von Feiertagen niemand gezwungen.
Übrigens stünde es nicht im Widerspruch zur Religionsfreiheit, wenn sich ein Staat eine Staatsreligion wählen würde â auch wenn es inzwischen keine modernen Staaten mehr gibt, die das noch für sich in Anspruch nehmen (die letzten Staaten mit einer Staatsreligion waren übrigens die protestantische Staaten in Skandinavien â oder Länder mit einer Staatskirche wie in England). Denn es gibt keinen grundsätzlichen Widerspruch zwischen Religionsfreiheit und Staatsreligion; meistens war eine Staatsreligion nämlich nicht mit der Pflicht der Bürger zur Annahme einer bestimmten Religion verbunden. Vielmehr ging es lediglich darum, mit welchen religiösen Ritualen Staatsakte gefeiert wurden und welche Religion zur Stützung von staatlichen Handlungen verpflichtet wurden. Die katholische Kirche lehnt für sich seit der Mitte des letzten Jahrhunderts eine solche Funktion ab; vor allem, um so einer Vereinnahmung durch den Staat zu entgehen.
Zu den Freiheiten der Religion gehört auch die Freiheit, interne Angelegenheiten selbst zu regeln. Dazu zählt zum Beispiel die Frage, unter welchen Voraussetzungen Mitglieder aufgenommen oder gegebenenfalls wieder ausgeschlossen werden. Auch die Formulierung von religiösen Pflichten ist vom Staat zu tolerieren; z. B. religiöse Bräuche (Gottesdienstbesuche, Fastengebote, Kleidungsvorschriften für Kleriker) oder die Verpflichtung zur moralischen Lebensführung (Eheschließung, Anstand und Wahrhaftigkeit). Auch eine Einführung eines eigenen kirchlichen Arbeitsrechtes, wie es in Deutschland existiert, ist grundsätzlich möglich. Diese Pflichten dürfen selbstverständlich über das hinausgehen, was der Staat von seinen Bürgern verlangt; es dürfen damit aber keine rechtswidrigen Zwänge verbunden sein: Der Staat hat dafür zu sorgen, dass jedem Bürger jederzeit die Freiheit bleibt, sich von den Verpflichtungen der Religion freizumachen und diese zu verlassen.
Natürlich kann auch der Staat mit einer Religion oder Kirche Verträge schließen und ihr Aufgaben übertragen. Kirchen können z. B. Schulen oder Krankenhäuser betreiben, wenn sichergestellt ist, dass dort auch weiterhin der Rechtsstaat Geltung hat. Umgekehrt kann auch der Staat Leistungen für die Kirche übernehmen; in Deutschland und Österreich gehört dazu der Einzug der Kirchensteuer (für diesen Dienst lassen sich die staatlichen Behörden allerdings auch gut bezahlen). Lediglich die Übertragung der Institute der Gewaltentrennung (die Rechtsprechung, die Polizei und die Gesetzgebung) kann und darf vom Staat nicht delegiert werden.
So kann nach und nach ein Geflecht von gegenseitigen Abhängigkeiten entstehen, das sowohl staatliches als auch kirchliches Handeln bindet; wenn diese Bindungen allerdings dazu führen, dass die Kirche oder der Staat ihre eigenen Aufgaben nicht mehr frei ausüben können, ist eine Grenze überschritten. Dann muss zur Wahrung der jeweiligen Selbstständigkeit über eine deutlichere Trennung und Entflechtung nachgedacht werden.
Der Staat hat seine eigene Freiheit, die darf ihm nicht von der Religion genommen werden. Der Priester darf auch den Getauften nicht alles vorschreiben, schon allein, weil er vom jeweiligen Alltag einfach keine Ahnung hat. Aber der Priester darf den Getauften â also auch den Politikern â Ziele und Grenzen predigen. Diese können dann vor allem die christlichen Politiker umsetzen. So wirkt die Kirche über die Predigt und die Bürger; dass Bischöfe oder Priester selbst und direkt politisch tätig werden (wie z. B. in der früheren Zentrumspartei oder als Staatsoberhäupter), ist von der Kirche inzwischen nicht mehr gewünscht. Religion wirkt also im christlichen Verständnis durch die Politiker und Bürger und nicht durch die institutionelle Einbeziehung von Kirchen in die Politik. Diese indirekte Einflussnahme ist wichtig â für Staat und Kirche. Sie muss daher staatlicherseits erlaubt, respektiert, ja: sogar gefördert werden. Ebenso muss der Staat (bzw. die Politik) das persönliche Gewissen der Politiker achten und schützen!
Ein Politiker, der z. B. gegen Abtreibung stimmt und sich dabei auf seine religiöse Überzeugung beruft, darf nicht von seinen Ämtern ausgeschlossen werden mit dem Argument, Staat und Religion seien zu trennen. (Nebenbemerkung: Tatsächlich ist die Frage nach der Erlaubtheit der Abtreibung gar keine religiöse Frage.)
Deshalb ist auch der Religionsunterricht, die Verkündigung in Predigt und Medien staatlich zu schützen: Weil die Kirche nicht in den politischen Gremien, sondern über die Politiker (und die Personen in der Gesellschaft) wirkt. (Dass der Religionsunterricht einen festen Platz an staatlichen Schulen hat, ist dafür nicht zwingend notwendig. Wenn der Staat diese Möglichkeit den Kirchen einräumt, dann ist das aber auch keine Verletzung der Neutralitätspflicht des Staates!)
«Die Lehre der Kirche ersetzt nicht das Gewissen der Christen!» â das haben wir oft gehört. Manchmal wird diese Erkenntnis wie eine Art Freibrief für moralische Beliebigkeit oder doch zumindest als Notausstieg in unangenehmen Zwickmühlen gesehen. Aber der Satz ist anders gemeint und damit grundsätzlicher: Die Lehre der Kirche sagt gar nicht, was wir ganz konkret tun sollen. Sie sagt, was Gut und Böse ist, welche Handlungen grundsätzlich verboten, eher schlecht oder tugendhaft sind. In konkreten Situationen muss dann jeder einzelne Christ mit diesem Wissen entscheiden, was er auf welche Weise kurzfristig oder langfristig erreichen will, welche Nebenwirkungen die Handlung mit welcher Wahrscheinlichkeit haben wird, und ob das angestrebte Ziel dadurch erreicht wird oder eher gefährdet. Alles DAS sagt die Kirche nicht.
Meine Predigt als Priester stellt also klar, was IST; wie die Wirklichkeit beschaffen ist. Da die katholische Kirche vom Naturrecht ausgeht, müssen wir also zuerst erfahren, was die Natur der Dinge und des Menschen ist. Was ist der Mensch? Was ist der Sinn Seines Lebens? Was ist die Welt? Was sind sinnvoller Ziele (Bewahrung der Schöpfung â Wirtschaftliche Interessen â Wohlfahrt â Gesundheit â etc.)?
Diese Zuordnung (Wirklichkeit erkennen â Handlungen daraus ableiten) lässt jeder Ebene ihre eigene Freiheit, die dennoch nicht unabhängig ist von der anderen. Die Religion ist der Politik vorgeschaltet (obwohl sie ihr nicht direkt hineinredet), weil sie von den Grundlagen, auf denen die Politik aufbaut, spricht. In diesem Sinne redet die Religion (insofern sie über die Wirklichkeit spricht) der Politik tatsächlich hinein. In diesem Sinne sind auch alle anderen Wissenschaften der Politik vorgeschaltet, weil sie in ihrer Wirklichkeitsbeschreibung die Grundlage für ein Handeln in der Wirklichkeit bieten. Für politische Entscheidungen müssen naturwissenschaftliche, technische, geografische und soziologische Erkenntnisse berücksichtigt werden; deshalb von einer unzulässigen Beeinflussung der Politik durch die Physik zu sprechen, ist sicherlich verfehlt.
So schreibt Papst Benedikt XVI. in seinem (nicht gehaltenen) Vortrag an der römischen Universität La Sapienzia: «Der Papst darf gewiss nicht versuchen, andere in autoritärer Weise zum Glauben zu nötigen, der nur in Freiheit geschenkt werden kann.» Vielmehr hätten Kirche und Universität eine gemeinsame Aufgabe zu erfüllen: Die Wahrheit und die Vernunft zu stärken. «Der Papst spricht als Vertreter einer Gemeinschaft, die zumindest einen Schatz an moralischer Erkenntnis und Erfahrung in sich verwahrt, der für die ganze Menschheit von Bedeutung ist: Er spricht in diesem Sinne als Vertreter moralischer Vernunft.»
Jürgen Habermas (neben John Rawls der bedeutendste Vertreter der liberalen politischen Philosophie) meint, die Kirche liefere einen unverzichtbaren Beitag zum moralischen Diskurs, und zwar wegen ihrer einzigartigen «Sinnressourcen». Und auch Gregor Gysi, bekennender Atheist und Linker, schreibt in seiner Autobiographie: «Ich weiß natürlich, dass das Christentum mehr als ein Moralprogramm ist. Glauben greift weiter als ein Aufruf zu humanitärem Sozialverhalten. Kirche begreife ich als wichtiges Regulativ für eine Kunst und Konsequenz der humanen Gebote, wie die Politik sie bei den Menschen nie erreichen kann!»
So spielt die christliche Theologie im Vergleich zu den anderen Wissenschaften (vor allem den nur «natur»-wissenschaftlichen Disziplinen) eine besondere und auch unverzichtbare Rolle, weil sie allein den Menschen in einer Ganzheit erfasst, die über das Biologische und Soziale hinausgeht: Der Mensch als geistiges Wesen â fähig zur Liebe, Erkenntnis, Schuld, Vergebung, Freiheit und Ewigkeit â wird in keiner anderen Einzel-Wissenschaft so umfassend gesehen.
Zu den wichtigen Erkenntnissen der christlichen Religion über Welt und Mensch gehört zum Beispiel, dass der Mensch erst seine Würde erhält durch seine sittliche Freiheit. Dem Menschen darf diese Freiheit niemals genommen werden (z.B. durch Folter); sie zu fördern ist oberstes Ziel der Politik. Oder: Der Mensch hat eine Neigung zum Bösen, ist aber in seinem Wesen gut. Es gibt niemals einen Menschen, der absolut böse ist. Der Mensch ist kein Triebtier und amoralisch, sondern hat einen inneren Antrieb, das Gute zu tun. Oder: Das Wesen des Menschen liegt in seiner Leib-Seele-Einheit. Der Leib ist zu schützen, um die Seele zu bewahren.
Weiter: Der Mensch ist über das Biologische hinaus als Mann und Frau verfasst, auch wenn es hin und wieder Personen ungeklärten Geschlechts gibt. Und: Der Mensch ist Mensch von Anfang an (ab der Befruchtung der Eizelle) bis zum letzten Atemzug, und er hat in der ganzen Zeit seine vollumfängliche Würde, weil er das Potential zur Freiheit und Geistigkeit (und zur Ewigkeit) hat.
Aber es gibt noch einen anderen Grund, weshalb die Religion der Politik unverzichtbar vorgeschaltet ist. Und zwar weil sie die Moral überhaupt erst begründet. Aus der reinen Wirklichkeitsbeschreibung lassen sich nämlich keine moralischen Imperative ableiten (das gilt grundsätzlich und darf nie vergessen werden, sonst werden wir demnächst von Technokraten regiert!). Vielmehr ist erst die Erkenntnis eines Sinns im Leben des Menschen Grundlage von Moral. Biologie, Geschichte und Soziologie reden aber nicht über den Sinn des Menschen, sondern nur über seine Existenz. Wenn wir die Sinnebene aber mitdenken, kommen wir zu drei wichtigen Voraussetzungen für die Politik:
Ersten gibt es in-sich-schlechte Handlungen, die immer und unter allen Umständen schweres Unrecht sind, weil sie sich gegen das Wesen des Menschen, den Sinn seiner Existenz richten. Diese Erkenntnis ist keine speziell-religiöse, sondern die Grundlage jeder Sittlichkeit und Moral; sie gilt für jeden Einzelnen und auch für die Politik. Der Staat muss die Bürger davor bewahren, Opfer solcher Handlungen zu werden; er soll aber auch die Bürger davor bewahren, solche Handlungen zu begehen. Das geschieht zum Beispiel durch Aufklärung und Sanktionen (Strafe), aber auch dadurch, dass der Staat verhindert, dass seine Bürger durch solche Handlungen Vorteile erlangen können.
Zweitens: Es gibt zwar Gebote, die in bestimmten Situationen klar zu befolgen sind (zum Beispiel Erste Hilfe bei Unfällen oder Nothilfe bei Verbrechen); aber es gibt keine Handlungen, die immer und überall und unter allen Umständen getan werden müssen. Das klingt banaler als es ist: Manchmal erweckt die Politik den Eindruck, sie müsse zur Rettung von Menschen über Leichen gehen. Manche glauben sogar, die Bewahrung von Tierarten rechtfertige die Tötung von Menschen, die Bewahrung vor Terror erfordere Folter etc. Es gibt Tugenden, Gebote und Taten, die in-sich gut sind; aber sie sind niemals absolut gefordert.
Und Drittens: Es gibt viele Handlungen, die moralisch überhaupt nicht festgelegt sind. Der Mensch muss nicht immer das Optimum wählen; er hat echte Wahlfreiheit. Die Gesellschaft und die Medien verurteilen schnell und gerne jeden, der Chancen verstreichen lässt und suboptimale Entscheidungen trifft. Man glaubt, dass jeder ein Recht auf maximal richtiges Verhalten des Anderen hat. Das ist aber nicht der Fall: Zur Moral gehört es, Freiheit (auch in der Moral) zu gewähren und die Anzahl der Regeln auf das Minimum zu beschränken. Dazu gehört (wie gesagt), das in-sich-Schlechte nicht zu tun und ansonsten die Würde und die Freiheit des Menschen zu respektieren, auch dann, wenn er sie nicht vollständig umsetzt.
Und, last but not least, gibt es eine ausformulierte theologische Disziplin, die sich «christliche Sozialwissenschaften» nennt und ebenfalls drei wesentliche Prinzipien kennt.
Menschen sind niemals Verfügungsmasse, Betriebskapitel oder nur Wahlgänger, Mehrheitsbeschaffer oder Befehlsempfänger. Menschen sind immer (!) Personen, selbst wenn sie schlecht handeln. Sie müssen nicht gehandhabt werden, sondern in Freiheit und Würde geachtet, eventuell angeleitet und gebildet, geschützt und gefördert werden. Der Mensch ist keine Volksmasse (gegen Kommunismus), aber auch kein Rassenangehöriger (gegen Nationalsozialismus), sondern Person: Gottes Ebenbild. Damit hat er Rechte und Pflichten, die ihm grundsätzlich zukommen (allein deshalb, weil er Person ist!) und ihm vom Staat nicht genommen werden dürfen.
Doch die Menschen sind nicht jeder für sich Selbstzweck. Der Sinn der Lebens verwirklicht sich erst im Füreinander und Miteinander: In der Solidarität. Das kann bis zur Selbstopferung (Maximilian Kolbe) gehen, wo der Mensch nicht etwa «sich selbst aufgibt», sondern zu seiner höchsten Fähigkeit gelangt: Das Wohl des anderen sogar über sein eigenes Leben zu stellen. Menschen bilden Solidargemeinschaften, weil sie wollen und so ihre Erfüllung finden.
Die profane Solidarität ist nach unserer christlichen Überzeugung nur ein Abbild der himmlischen «Communion Sanctorum» (der Gemeinschaft der Heiligen). Auf diese Gemeinschaft hin sind alle Menschen angelegt, auch wenn sie es gar nicht wissen.
Die Frage, wie sich Personalität und Solidarität in der Waage halten, ist so wichtig, dass es sich dabei um ein eigenes, schützenswertes Prinzip handelt: Die Subsidiarität. Wie schon beim Verhältnis von Staat und Kirche sind Personalität und Solidarität zwei Ebenen, die auf eine einfache, aber ganz wichtige Weise einander zugeordnet sind: Was eine untere Ebene kann, darf ihr von einer nachgeordneten Ebene nicht genommen werden. Was eine untere Ebene allerdings nicht schafft, muss von der ihr nachgeordneten Ebene geleistet werden. Oder: Jeder soll das tun, was er kann; und das darf ihm nicht genommen werden.
Das ist wichtiger, als es klingt. Elternrechte dürfen z. B. niemals vom Staat beschnitten werden â es sei denn, die Eltern sind erwiesenermaßen überfordert und gefährden das Kindeswohl. Aber dieser Nachweis muss erbracht werden! Denn die Elternrechte sind Personenrechte! Der Staat darf also nur das regeln, was der Einzelne oder mittlere Ebenen (Kommunen, Kreise, Länderregionen) nicht mehr selbst regeln können.
Sind die linken Parteien aufgrund ihrer sozialen Ausrichtung automatisch die christlicheren Parteien? â Nein. «Links» meint zumeist eine Überbetonung der Solidarität auf Kosten der Personalität. Eine Überbetonung des Staates auf Kosten der Subsidiarität. Das ist nicht christlich. Wer NUR sozial denkt, ist nicht christlich.
Sind die rechten Parteien aufgrund ihrer konservativen Haltung die christlicheren Parteien? â Nein, ebenfalls nicht. «Rechts» heißt in diesem Zusammenhang nicht einfach nur konservativ, sondern zeichnet sich durch eine Überbetonung des Staates auf Kosten der Personalität eines jeden Menschen aus. Solidarität wird nicht einem jeden Menschen, sondern nur den Staatsangehörigen zugebilligt.
Sind die liberalen Parteien aufgrund ihrer Betonung des eigenverantwortlichen Handelns der Menschen die christlicheren Parteien? â Nein, auch das nicht. Die liberale, zumeist kapitalistisch orientierte Politik betonte zwar die Personalität der Menschen, oft aber auf Kosten der Solidarität.
Nur, wer eine gute Balance in einer sozial-personal-subsidiarischen Politik findet, die die Grundlagen der naturrechtlichen Moral akzeptiert, kann von sich behaupten, christliche Politik zu betreiben.
Christliche Werte gibt es eigentlich nicht â oder zumindest viel weniger, als wir so glauben. Manche meinen, dass Werte grundsätzlich eine Erfindung von Religion sei (denn aus den Naturwissenschaften kommen sie nicht â also bleibt nur noch die Religion, oder?). Aber das ist weder vernünftig noch Überzeugung der Religionen selbst. Vielmehr sind Werte zwar keine materielle Eigenschaften der Wirklichkeit, aber dennoch real: Entweder existieren die Werte in der Wirklichkeit â dann für alle und jeden; oder sie existieren nicht, dann wäre es wirklichkeitsfremd, solche zu behaupten. Sie liegen allerdings nicht in den Dingen selber, sondern beschreiben das Verhältnis, in dem der Mensch zu Wirklichkeit steht.
Das Verhältnis, in dem der Mensch zur Wirklichkeit steht, ist aber nicht etwas, das er willkürlich und nach eigenem Geschmack selbst bestimmt. Manche Zeitgenossen glauben das: Jeder mag selbst definieren, was er gut findet oder nicht.
Tatsächlich steht der Mensch grundsätzlich in einem Verhältnis zur Wirklichkeit, dass er nur in geringen Teilen selbst definieren kann. Ansonsten ist es ihm vorgeben (das nennen wir «Naturrecht») aufgrund seiner Existenz. Elternrechte (und -pflichten), seine Würde, Freiheit und Verantwortung, die Hinordnung auf Wahrheit und Wahrhaftigkeit, Würde und Schutz seiner Beziehungen, das Angewiesensein auf Solidarität, Gemeinschaft und Zuwendung: Alles das sind im Wesen des Menschen verankerte Gegebenheiten, die vom Menschen nicht erworben oder gewählt werden.
Jeder Mensch und jeder Politiker hat einen Katalog von Werten, der seinem Handeln zugrunde liegen. Das ist nicht an die Religiösität des Menschen gebunden! Der Gedanke, Religion hätte also in jeder Gesellschaft die Aufgabe, für die Werte zu sorgen, weil diese ansonsten verloren gingen, ist im Grunde eine Diskriminierung von Religionslosen: Selbstverständlich haben auch diese Werte und sind zu wertorientiertem Handeln in der Lage!
Allerdings kann es sein, dass in einer Gesellschaft Werte »verloren gehen«, also etwas zunehmend in Vergessenheit gerät, was als Erkenntnis der Realität zuvor schon als gesichert galt.
Zehren wir nicht von dem christlichen Menschenbild, das die Missionare den Germanen etc. in jahrhundertelanger Bildung eingeimpft haben? Auch die Griechen hatten ja ihre blinden Flecken, was das Wesen und die Würde des Menschen angeht, ganz zu schweigen von den Römern...
Da kann die Religion hilfreich sein, solange sie der Gesellschaft entgegenzutreten weiß und sich nicht in der Anbiederung an den Zeitgeist verliert.
Dazu könnten gehören:
- Schutz des Lebens vom Anfang bis zum Ende: Dass auch das Ungeborene ein eigenständiges Lebewesen, ein Mensch und eine Person ist â und zwar mit Beginn der Befruchtung, ist keine Erfindung der Religion, sondern eine Realität. Diese wird aber zur Zeit vor allem von den Kirchen wach gehalten; dennoch ist der Widerstand gegen die gängige Abtreibungspraxis kein religiöses Tun.
- Wahrung der Freiheit: Die Tendenzen, unsere Gesellschaft zu einem Hochsicherheitstrakt zu gestalten und jede böse Tat bereits im Keim zu verhindern, zerstört letztlich die Freiheit des Menschen. Dass wir mit Schuld, Leid und Verbrechen immer leben werden, weil wir die Freiheit des Menschen schützen, ist vermutlich ein Zusammenhang, für dessen Erkenntnis wir die Kirchen brauchen.
- Religionsfreiheit, die Freiheit aus Religionsausübung und Religionswahl: Natürlich liegt den Kirchen daran, ihre eigene Freiheit zu sichern. Aber der Einsatz für die Religionsfreiheit geht weit über einen eventuellen «kirchlichen Eigennutz» hinaus; er umfasst vor allem freie Bestimmung, welchen letzten Sinn mein Leben hat. Tendenzen, religiöse Zeichen (Kopftuch-Debatte), Bekenntnisse und Auftritte aus der Öffentlichkeit zu verbannen, tritt zur Zeit wohl hauptsächlich die Kirche machtvoll entgegen.
- Übrigens: Nächstenliebe ist kein Wert. Der «Nächste» wäre ein Wert! «Nächstenliebe» beschreibt vielmehr den Umgang mit diesem Wert. Die «Feindesliebe» ist allerdings deutlich brisanter, denn sie setzt voraus, dass der Feind (insofern er Mensch ist) ebenfalls ein Wert ist. Ein Feind, Verbrecher oder Terrorist verliert also sein Würde als Mensch nicht dadurch, indem er anderen ihre Würde abspricht.
Nun hat die Kirche bei der Findung von Werten keine Monopolstellung; auf der anderen Seite spielt sie natürlich schon eine wichtige Rolle in der Wertedebatte. Und zwar in doppelter Hinsicht:
(1) Nur wer glaubt, berücksichtigt bei der Findung von Werten auch die gesamte Wirklichkeit. Materialisten blenden einen großen Teil der Realität aus; Religionen helfen, diese Realitäten neu zu entdecken bzw. zu bewahren.
(2) In der Gesellschaft wie im privaten Leben drehen sich moralische Diskussionen selten um die Werte an sich, sondern eher um die Rangfolge, in der diese Werte stehen. Darf ich, um Wert-1 zu erreichen, Wert-2 hintanstellen? Gerade in dieser Hinsicht hat die Kirche einen wichtigen Beitrag zu geben.
Bevor wir uns der wesentlichen Frage bezgl. der «Hierarchie der Werte» zuwenden, sei natürlich noch darauf verwiesen, dass es auch eindeutig christliche Werte gibt, die von Nicht-Christen nicht als solche gesehen werden: Dazu gehören zum Beispiele alle religiösen Handlungen im engeren Sinne (wie zum Beispiel der Gottesdienstbesuch, das Gebet, der Sakramentenempfang und das Feiern von religiösen Festen); aber auch religiöse Bräuche, die sich daraus entwickelt haben (wie z.B. die Fastenzeit, Stille, die Heiligung des Sonntags usw.). Nicht immer lassen sich religiöse Werte eindeutig von bürgerlichen Konventionen trennen (z.B. die Ehrfurcht Gott gegenüber, die Vermeidung von Blasphemie, Geschlechterrollen, Konventionen rund um die Eheschließung und das Eheleben). Die Verschmelzung von Religion und Gesellschaft in bestimmten Traditionen muss allerdings nicht notwendig schlecht sein: Sie ist letztlich eine Frucht eines Glaubens, der sich auch im Leben auswirkt.
Viel wichtiger als der Wert an sich ist die Rangordnung der Werte. Das ist oft die entscheidend christliche Frage: Steht die Wohlfahrt des Staates höher als die Freiheit des Einzelnen? Darf um der Sicherheit des Volkes willen die Freiheit der Bürger eingeschränkt werden? Steht die Freiheit der schwangeren Frau über dem Lebensrecht des ungeborenen Kindes? Steht das Wohl des eigenen Volkes über dem von Nicht-Deutschen? Nicht-Europäern? Nicht-Christen? Das ist die manchmal schwierigere Frage. Alles das sind Werte, das ist unbestritten. Aber welcher Wert darf für einen anderen geopfert werden?
Dabei hilft uns bis zu einem bestimmten Grad die Moral oder Ethik. Dort haben sich drei grundlegende Konzepte etabliert (in vielen, vielen Abwandlungen und Schattierungen), die nur zusammengenommen ein stimmiges Bild bieten. (Ausführlicher werden diese Konzepte in der Katechese zur ![]() »Moral« vorgestellt).
»Moral« vorgestellt).
So gibt es zum Beispiel Theoretiker, die behaupten, dass Gut und Böse immer relativ seien: Was des einen Freud' ist des anderen Leid. So ist gut für den Dieb, reiche Beute zu machen â und schlecht für den Bestohlenen, der nun ärmer ist als zuvor. Solche Philosophen nennen wir Relativisten.
Wir wollen diese Konzepte nicht alle diskutieren â dazu fehlt hier die Zeit. Gegen den Relativismus lässt sich argumentativ nur schwer angehen. Die Erfahrung des Menschen steht dem allerdings klar entgegen: Wenn jemand sein Leben riskiert und verliert, um jemand anderem das Leben zu retten, sagen wir ja auch nicht, dass die Handlung für den Geretteten gut war, aber aus Sicht des Retters böse.
Andere halten an der Relativität von moralischen Urteilen fest, gehen aber davon aus, dass nun ein Gesetzgeber festlegt, was gut und böse ist (weil es die Einzelnen ja jeweils anders sehen). Wenn also Diebstahl unabhängig von Kultur und Gesetz weder gut noch böse ist, sondern erst durch einen Gesetzgeber dazu erklärt werden muss, sprechen wir von Positivismus. (Das hat nichts mit «positiv und negativ» zu tun. Der Begriff «Positivismus» leitet sich vom lateinischen ponere = setzen, stellen, legen ab. Der Positivist glaubt also, es ist nur das gut (und böse), was von einer entsprechenden Autorität festgelegt, festgesetzt oder als Gesetz aufgestellt wird.)
Positivisten sind deshalb schwer mit Argumenten zu überzeugen, weil sie im Grunde gar nicht argumentieren. Es ist egal, wieviel Argumente für oder gegen eine moralische Ansicht sprechen: Entscheidend ist allein, ob etwas verboten oder erlaubt ist. Punktum. (Deshalb ist diese Theorie bei Fundamentalisten sehr beliebt â und bei ein wenig unterbelichteten Zeitgenossen, die sich das Selber-Denken gar nicht erst angewöhnt haben: «Wo steht, dass das verboten ist? Also!»)
Relativisten und Positivisten scheinen einander entgegengesetzt zu sein; während der Positivist ständig nach den Vorschriften fragt, überlässt der Relativist die Frage nach gut und böse dem Geschmack des einzelnen. Dennoch ist beiden gemeinsam, dass sie eine Diskussion über eine moralische Wirklichkeit mit dem gesunden Menschenverstand für unnötig halten. Sie glauben nicht, dass so etwas wie «gut» und «böse» in der Wirklichkeit und über alle Zeiten hinweg existiert.
Andere wiederum glauben schon, dass es gute und schlechte Taten unabhängig von Gesetz und Geschmack gibt â und zwar, indem sie auf die Folgen einer Tat schauen. Die Handlung selber ist eben nur eine Handlung â aber sie wird gut oder böse, gewünscht oder zu vermeiden durch die eher positiven oder negativen Folgen. Dieses moralische Konzept nennt sich Utilitarismus â vom lateinischen utilitas: der Nutzen. Manche nennen dieses Konzept auch teleologische Moral â von griechisch telos: das Ziel. Die Handlung erhält also ihren moralischen Wert durch das Ziel, auf das sie gerichtet ist; dieses Ziel sollte bestenfalls für alle von der Handlung Betroffenen optimal sein.
Das Problem dieser Richtung der Moralphilosophie besteht in der Einschätzung, wann eine Folge optimal ist â und ob man unerwünschte Folgen gegen die gewünschten Folgen aufrechnen darf. Und ob die Anzahl der positiven Folgen oder die Qualität entscheidend ist. Ob damit alle Folgen gemeint sind, die eine Handlung jemals haben wird â oder nur die vorhersehbaren oder die unmittelbaren... und so weiter.
Peter Singer zum Beispiel meint, dass man nur die Präferenzen der Betroffenen gegeneinander rechnen darf; Kleinkinder und Schnecken dürfen daher getötet werden, da sie keine anderen Präferenzen (sprich: Pläne) hätten, als schmerzfrei zu leben.
Neben diesen grundlegenden Konzepten gibt es noch weitere moralische Strategien (meist als Variationen zu den genannten), die alle etwas gemeinsam haben: In bestimmten Bereichen haben sie durchaus ihre Gültigkeit â aber sie taugen nicht zu einer allgemeinen Moral.
So ist die Regelung des Straßenverkehrs weitestgehend positivistisch: Gut und böse handelt jeweils der, der sich an die Regeln hält oder sie verletzt. Linksfahren ist an sich nicht von Übel (die Briten sind ja auch keine schlechteren Menschen oder Autofahrer); dennoch ist es böse, vorsätzlich in Deutschland links zu fahren. Tatsächlich sind zahlreiche Gebote und Gesetze kulturbedingt â so z. B. das Tragen bestimmter Kleidungen in der Öffentlichkeit oder die Definition dessen, was als Beleidigung angesehen wird.
Zudem sind die meisten unserer alltäglichen Entscheidungen moralisch irrelevant: Ob ich nun links oder rechts um den Baum herum gehe, ist weder von Übel noch von Nutzen, vermutlich ist auch die Frage, ob ich das Ei an der spitzen oder runden Seite aufschlage, moralisch gleichgültig. Das mag jeder so machen, wie er lustig ist.
Ebenfalls gilt, dass ich bei folgenreichen Entscheidungen die Konsequenzen bedenke und versuche, sie gegeneinander abzuwägen. Ob ich mein Geld für einen Urlaub verwende oder damit das Studium meines Kindes finanzieren möchte, das eventuell gar nicht studieren will, dafür meine Frau aber dringend Urlaub braucht, ich aber gerade jetzt in der Firma nicht fehlen kann... Alles das werde ich selbstverständlich bedenken, wenn ich mich entscheide. Wenn möglich, werde ich so handeln, dass die Folgen für möglichst viele Menschen (für mich, mein Kind und meine Frau und meine Firma und die Urlaubsindustrie) angenehm und wünschenswert sind.
Aber selbst in den Bereichen, in denen wir zunächst positivistisch (relativistisch â utilitaristisch â etc.) handeln, setzt uns eine allgemeine Moral Grenzen.
Im Straßenverkehr regeln die Gesetze, wie schnell ich fahren darf; dennoch dürfte es leichtsinnig oder gar verwerflich sein, mit der erlaubten Geschwindigkeit in eine Schafherde zu rasen.
Und auch, wenn es meine ganz persönliche moralische Entscheidung ist, wie ich mich kleide, kann es unmoralisch sein, auf einem schwarz-afrikanischen Beerdigungskaffee in der Kleidung des Ku-Klux-Klans zu erscheinen. Und auch der Utilitarismus hat seine zahlreichen Grenzen: So darf ich den im Wartezimmer eines Arztes sitzenden Ehemann einer Patientin nicht einfach töten und seine Organe in 22 dem Tode geweihte Personen verpflanzen, selbst wenn ich nur einen Menschen töte und dafür 22 anderen das Leben rette (und auch dann nicht, wenn der nette Ehemann sich freiwillig dazu bereiterklärt!). â Ebenfalls darf ich nicht auf Experten hören, die mir sagen, dass ich während einer Versuchsreihe einen anderen Menschen ruhig quälen dürfe: ich würde damit die Wissenschaft enorm voranbringen. â Selbst Experten, die mehr Folgen überblicken, als ich es tue, entbinden mich nicht von meiner Verantwortung. â Auch einem Erpresser, der von mir einen Mord an Unschuldigen fordert, darf ich nicht nachgeben, auch dann nicht, wenn er droht, ansonsten den Mord selbst zu begehen und darüber hinaus noch zahlreiche weitere. â Es ließen sich leicht noch viele weitere Beispiele finden.
Jedes vorläufige moralische Konzept kommt an eine absolute Grenze, die wir das «Naturrecht» nennen. Dieses Naturrecht gilt für alle Menschen, zu allen Zeiten und in allen Kulturen und setzt den oft sehr unterschiedlichen lokalen oder zeitbedingten Bräuchen eine moralische Grenze. So ist zu keiner Zeit Vergewaltigung, Mord oder Folter erlaubt, selbst wenn es die Mehrheit einer Gesellschaft praktiziert oder die Gesetze eines (Unrechts-)Staates es erlauben sollten. Ein Teil dieses Naturrechts findet sich in den Menschenrechten wieder, die gerade deshalb formuliert wurden: Weil kein Staat sie durch Gesetze (gegen den Positivismus) oder durch persönliche Vorlieben (gegen den Relativismus) oder in besonderen Notlagen (gegen den Utilitarimus) außer Kraft setzen kann.
Es gibt also in der Moral und somit auch in der Politik verschiedene Ebenen, die hierarchisch einander zugeordnet sind. So gibt es Lebensbereiche, die positivistisch sind (gut ist, was als gut festgelegt wurde) und es gibt Bereiche, die utilitaristisch sind (gut ist, was den größten Nutzen hat). So darf man denken â aber nicht immer und nicht überall. Diese Bereiche sind durch ein übergeordnetes Prinzip (das Naturrecht) einander zugeordnet.
Es ist gut und vernünftig, nach einem Verbrechen, Terrorakt oder Unglück zu fragen, wie das passieren konnte. Es soll ja möglichst in Zukunft alles getan werden, um erneutes Leid zu verhindern. Also müssen die Abläufe rekonstruiert werden â verbunden mit der Frage, wer Schuld hat und was letztlich zur Katastrophe geführt hat.
Schwierig wird es dann, wenn diejenigen, die ein Verbrechen hätten verhindern können, unreflektiert eine Schuld am Verbrechen zugewiesen bekommen. Ja, manchmal scheint es, dass eine Behörde, die einen Terroranschlag nicht verhindert hat, mehr Schuld am Terrorakt habe als der Täter. So, als wäre der Täter eher ein Maschine â und die staatlichen Sicherheitsbehörden die Maschinenführer, die dafür verantwortlich sind, das alles vorschriftsmäßig funktioniert.
Das ist mehr als nur eine nebensächliche Beobachtung über das Medienverhalten im Anschluss an Katastrophen. Wenn wir nämlich nicht mehr unterscheiden zwischen einem Zugführer, der seine Pflicht verletzt (und dann tatsächlich schuld ist am Zusammenstoß mit einem Güterzug) und Behörden, die nicht mit Maschinen, sondern Menschen zu tun haben, dann reduzieren wir nicht nur Täter auf Automaten. Vielmehr laufen wir Gefahr, mit zusätzlichen Forderungen nach weiterer Kontrolle alle anderen Bürger ebenfalls wie seelenlose Automaten zu behandeln, die dann durch ausreichende Sicherheitsmechanismen nicht mehr aus dem Ruder laufen können.
In Wirklichkeit trifft die Schuld an einem Verbrechen immer ersteinmal den Täter. Er ist schuld â und diese Schuld kann ihm nicht genommen werden, indem auf die Untätigkeit anderer verwiesen wird.
Natürlich sind Zeugen eines Verbrechens zur Nothilfe aufgefordert; wenn sie diese unterlassen, laden sie eine eigene Schuld auf sich: Die Schuld der unterlassenen Hilfeleistung. Aber das ändert nichts daran, dass die Ursache des Verbrechens weiterhin im freien Entschluss des Täters liegt, der beschlossen hat, Böses zu tun.
Es gibt in jeder Gesellschaft Menschen, die beschließen, Böses zu tun. Diese Möglichkeit liegt in der menschlichen Freiheit. Der Ruf danach, der Staat möge das Böse grundsätzlich verhindern, ist letztlich ein Ruf nach Abschaffung dieser Freiheit! Natürlich ist der Wunsch, der Staat möge seine Bürger bestmöglich schützen, vernünftig. Aber der Schutz durch den Staat darf nicht so weit gehen, dass die Freiheit der Bürger selbst schon unterbunden wird â auch nicht die Freiheit, Böses zu tun.
Der garantierte Schutz der Freiheit der Bürger und der gleichzeitige Schutz der Bürger vor Verbrechen ist eine Quadratur des Kreises. Diese Erkenntnis ist für die Politik wichtig â aber auch für die Reaktionen der Medien, der Bürger und der Einwohner eines Landes. Letztlich ist diese Frage eng verwandt mit der »Theodizee«, also der Frage, warum Gott das Leid zulässt: Wenn Gott alles Leid verhindert, würde er auch die Freiheit des Menschen aufheben. Nun sollte man vom Staat nicht etwas verlangen, was selbst für Gott ein Widerspruch ist.
Ich will das Problem hier nicht zu sehr vertiefen. Nur ein Einwand sei erwähnt: Manche meinen, der Staat möge zwar die Freiheit der Bürger schützen, aber immer dann eingreifen, wenn diese Freiheit zu einer Handlung führt, die anderen Leid zufügt. Das ist allerdings nur ein frommer Wunsch: Denn selbst wenn es dem Staat möglich wäre, im richtigen Augenblick zwischen der Willensfreiheit («Ich möchte Böses tun!») und der daraus folgenden Handlung («Ich tue Böses. Jetzt. Sofort.») einzugreifen («Halt, Stop! Hände hoch!»): Die saubere Trennung zwischen einer Absicht (Willensfreiheit) und der Handlung (Handlungsfreiheit) ist in der Realität nur selten möglich.
Hinzu kommt: Keinem Menschen darf Gewalt angetan werden, weil er eine Handlung beabsichtigt oder in Erwägung zieht (siehe Ferdinand von Schirach â oder dem Spielberg-Film «Minority-Report»). Wir dürfen Menschen nur aufgrund von Taten verurteilen, nicht aufgrund von Absichten. Auch die Verurteilung eines Täters wegen «Vorbereitung einer schweren Straftat» setzt voraus, dass bereits Handlungen nachgewiesen wurden â und nicht nur Absichten gehegt.
Die innere Sicherheit eines Staates hängt also mehr von der moralischen Integrität der Bürger ab als von flächendeckenden Kontrollmechanismen. Die innere Bildung des Menschen geschieht aber nicht durch staatliche Verordnungen, sondern durch ein Zusammenwirken aller gesellschaftlichen Kräfte. Und zu denen gehören auch die Kirche und die Religion.
Im Gegensatz zur reinen Wissenschaft lebt die Politik von der Fähigkeit, Kompromisse zu schließen.
Das hat sie übrigens mit der Pastoral gemeinsam: Die Theologie (auch die Moraltheologie) kann relativ leicht Eindeutigkeit herstellen; in der Seelsorge ist dagegen die Fähigkeit gefragt, mit den real-existierenden Ressourcen zu arbeiten.
Deshalb ist die Frage, wie weit sich die reale Politik von ihren Grundsätzen entfernen darf, ohne sie zu verraten, auch ein Grundfrage der Kirche. Dazu zwei Beispiel:
(1) Einmal angenommen, zwei Entwürfe zu einer Regelung der Abtreibung liegen dem Parlament vor. Darf ein christlicher Politiker für ein Gesetz zur Regelung von Abtreibungen stimmen, das zwar unmoralische Praktiken erlaubt, das aber immer noch besser ist als die Alternative? Ein dritter Entwurf, der ganz und gar christlich vertretbar wäre, käme mit Sicherheit nicht durch â die Stimmen für diesen dritten Entwurf würden dann allerdings dem gemäßigten Gesetz fehlen.
(2) Darf ich als Wähler einer Partei die Stimme geben, die zwar einige Punkte im Parteiprogramm enthält, die sie für einen Christen eigentlich unwählbar machen.
Andere zur Wahl stehenden Parteien sind dagegen noch weniger tragbar. Die wenigen Parteien, deren Parteiprogramm auch für einen Christen annehmbar ist, haben keine Chancen, in das jeweilige Parlament zu kommen.
Sowohl für Politiker, als auch für Wähler sollten die (christlichen) Grundsätze klar und wertvoll sein; dennoch kann es notwendig sein, davon abzuweichen. Was sagt die Kirche dazu?
Verblüffend viel! Zunächst ist es wichtig, die Schwere der Grundsätze zu erkennen. Eine Streichung des Kindergeldes ist weniger gewichtig als die Freigabe von aktiver Sterbehilfe; auch wenn die Förderung der Familie eine wichtige Aufgabe des Staates ist, ist das Kindergeld nicht absolut gefordert â der Schutz des Lebens vor aktiver Tötung allerdings schon. Die Freigabe oder gar Förderung in-sich-schlechter Handlungen gehört zu den No-Go's christlicher Politik.
Deshalb ist ein christlicher Politiker (durch sein Gewissen) aufgefordert, solche Vorhaben abzulehnen. Wenn dies jedoch effektiv nicht möglich ist, dann darf er zwar für das geringere Übel stimmen (also ein weniger abzulehnendes Gesetz), muss aber öffentlich und klar deutlich machen, dass dies gegen seine christliche Überzeugung aus politischer Notwendigkeit heraus geschieht.
In Evangelium vitae heißt es zunächst (Abschnitt 73): «Es ist daher niemals erlaubt, sich einem in sich ungerechten Gesetz, wie jenem, das Abtreibung und Euthanasie zulässt», anzupassen, «weder durch Beteiligung an einer Meinungskampagne für ein solches Gesetz noch dadurch, dass man bei der Abstimmung dafür stimmt».
Aber es heißt im gleichen Abschnitt: «Ein besonderes Gewissensproblem könnte sich in den Fällen ergeben, in denen sich eine parlamentarische Abstimmung als entscheidend dafür herausstellen würde, in Alternative zu einem bereits geltenden oder zur Abstimmung gestellten ungleich freizügigeren Gesetz ein restriktiveres Gesetz zu begünstigen, das heißt ein Gesetz, das die Anzahl der erlaubten Abtreibungen begrenzt. (...) In dem hypothetisch angenommenen Fall ist es einleuchtend, dass es einem Abgeordneten, dessen persönlicher absoluter Widerstand gegen die Abtreibung klargestellt und allen bekannt wäre, dann, wenn die Abwendung oder vollständige Aufhebung eines Abtreibungsgesetzes nicht möglich wäre, gestattet sein könnte, Gesetzesvorschläge zu unterstützen, die die Schadensbegrenzung eines solchen Gesetzes zum Ziel haben und die negativen Auswirkungen auf das Gebiet der Kultur und der öffentlichen Moral vermindern. Auf diese Weise ist nämlich nicht eine unerlaubte Mitwirkung an einem ungerechten Gesetz gegeben; vielmehr wird ein legitimer und gebührender Versuch unternommen, die ungerechten Aspekte zu begrenzen.»
Das gilt dann natürlich auch für den Wähler und die Wahl einer Partei.
Dennoch muss betont werden, dass es zwar erlaubt ist, einer Partei die Stimme zu geben, die nur das geringere Übel darstellt; besser wäre es jedoch, eine moralisch unbedenkliche Partei zu wählen. Der Hinweis, diese zu wählen sei eine Verschwendung der Stimme, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir (als Politiker, Wähler und Bürger) alles daran setzen müssen, in der Politik wieder wählbare Parteien zu etablieren.
Denn so wichtig wie die Fähigkeit zum Kompromiss auch ist: Eine Wahrheit darf niemals auf längere Sicht verbogen werden, sonst verliert der Mensch den Zugang zu ihr.
