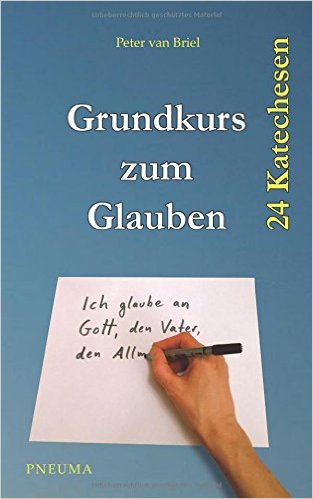Neue Site - empfehlenswert! Ein Ableger der Karl-Leisner-Jugend: aktueller, kürzer, frischer und moderner: www.gut-katholisch.de.
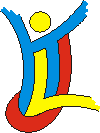 |
KARL-LEISNER-JUGEND |
Grundkurs des Glaubens - Die Moral
|
| I. Religion und Moral | ||
| 1. Die missverstandene Moral | ||
| 2. Die recht verstandene Moral | ||
| 3. Welche Rolle die Religion in der Moral spielt | ||
| II. Moralphilosophie | ||
| 1. Begriffsklärung: Was ist »gut«? | ||
| 2. Philosophische Konzepte der Moral | ||
| a. Relativismus | ||
| b. Positivismus | ||
| c. Utilitarismus | ||
| 3. Das Naturrecht - das moralische Erkennen | ||
| a. Zwischen zwei Hoffnungen - zwischen zwei Übeln | ||
| b. Güterabwägungen mit Nebenwirkungen | ||
| c. Echte Tragik | ||
| III. Moral und Religion | ||
| 1. Religiöse Vorschriften für alle?! | ||
| 2. Moral als Tür in den Himmel | ||
| 3. Moral und Gnade | ||
In einer Radio-Sprechstunde des Deutschlandfunks (DLF) zu Fragen von Ehe und Partnerschaft fiel der denkwürdige Satz einer Paartherapeutin: Eine »offene Partnerschaft sei nicht etwa aus moralischen Gründen abzulehnen, sondern vielmehr, weil sie durchaus Schaden anrichten könne.« Aha.
Moral - das ist demnach ein überkommenes Wertesystem, das dem Menschen auferlegt wird. Was aber zum Glück führt oder eher Leid bereitet (für mich oder für andere oder sowohl als auch), das hat in der Aussage der Paartherapeutin des DLF nicht in erster Linie etwas mit Moral zu tun, sondern mit Erkenntnis, gesundem Menschenverstand und Rücksichtnahme. In diesem (verkehrten) Sinne wäre Moral eine religiöse Sache: »Ich habe keine Ahnung, warum die Gebote so aussehen und beschaffen sind, ich übernehme sie letztlich, weil sie zu einer Religion dazugehören, der ich (aus welchen Gründen auch immer) angehöre.«
In diesem Sinne ist Moral allerdings etwas zutiefst Unchristliches.
Denn Moral ist in einem recht verstandenen Sinn kein übernommenes Wertesystem, sondern die Frucht von Erkenntnis, gesundem Menschenverstand und Rücksichtnahme. Eine gute christliche Moral besteht nicht aus einer freischwebenden Gebotesammlung, sondern aus der Erkenntnis, was es ist, das letztlich zum wahren Glück führt. Aus dem gesunden Menschenverstand, der mir zeigt, was davon auch machbar ist. Und aus einer guten Portion von Rücksichtnahme, die nicht nur mein Wohlergehen, sondern auch das der anderen Menschen im Blick hat.
Ein moralisch denkender Mensch versucht zunächst zu erkennen, wie die Wirklichkeit beschaffen ist und welche Handlungen dieser Wirklichkeit am ehesten gerecht werden. Dabei geht es nicht zuerst darum, Regeln und Gebote aufzustellen, sondern herauszufinden, was gut ist, welcher Zustand gut ist, welcher Weg dorthin führt und welche Schritte dazu unternommen werden müssen. Dabei bleibt der Moraltheologe zunächst rein beschreibend: Er stellt fest, welche Handlungen dem Wesen des Menschen entgegengesetzt sind, welche dem Menschen entsprechen und welche mehr oder weniger unentschieden irgendwo dazwischen anzusiedeln sind. Von Geboten, Verboten und Strafen ist hier noch nicht im Geringsten die Rede.
Da es also nicht darum geht, Menschen durch Belohnung, Strafe, Gebot oder Verbot ein Verhalten anzuerziehen oder aufzuzwingen, sondern zu fragen, was gut ist, kann (und muss!) man über diese Erkenntnisse eifrig und gewissenhaft diskutieren. Moraltheologie ist also von ihrem Wesen her nicht das Ende einer Diskussion, sondern die Durchführung einer Diskussion. Eine moraltheologische Argumentation hat als Ziel nicht das Verbot einer Handlung, sondern die Erkenntnis, was angesichts der Wirklichkeit Glück fördert oder Leid verhindert.
In diesem Sinne ist Moraltheologie im Grunde nicht Theologie, sondern Philosophie: also das natürliche Nachdenken eines jeden Menschen über die Qualität seiner Handlungen. Das Theologische daran ist nicht, dass Gott (oder die Kirche) das Nachdenken über die Wirklichkeit beendet, indem er einfach ein Gebot erlässt. Die religiöse Bedeutung der Moral ersetzt also nicht die allgemeingültige Moralfindung, sondern ist ihr vielmehr vorgeschaltet, begleitet sie und ist ihr nachgeordnet.
(a) Vorgeschaltet: Im Gegensatz zu einer materialistischen Moral (falls es so etwas überhaupt gibt) nehmen wir Christen die Realität umfassender wahr. Zur Erkenntnis der Wirklichkeit gehört für uns auch die unsichtbare Wirklichkeit: Seele, Unsterblichkeit, Engel, Gott und »der Himmel«. Abgesehen von einem solch erweiterten Realitätsbegriff bleibt das restliche Vorgehen der Moralfindung unverändert: Immer noch fragen wir uns, wie wir angesichts dieser nicht reduzierten Wirklichkeit des Menschen glücklich werden und Leid vermeiden oder vermindern können.
(b) Begleitend: Haben wir erkannt, wie die Wirklichkeit beschaffen ist und was zu tun ist, um im Einklang mit dieser Realität das Glück zu finden, bleibt noch die Frage, ob das überhaupt möglich ist - grundsätzlich (aufgrund der verzwickten Zusammenhänge in dieser Welt) und persönlich (aufgrund meiner begrenzten Kräfte und mangelnder Übung). Auch hier kommt der Christ zu einer vielleicht veränderten Sicht, weil er nicht nur die Handlungen des Menschen in Betracht zieht, sondern auch die Schritte, die Gott unternimmt, um uns das Glück zu ermöglichen, und die Kräfte, die er uns verleiht, wenn wir gut sein wollen. Ob z.B. der Weltfrieden eine feine Sache ist oder nicht, ist keine religiöse Frage. Ob meine kleinen Taten dazu überhaupt etwas beitragen, und ob meine Kräfte ausreichen, auch durchzuhalten: das ist durchaus abhängig von meiner religiösen Überzeugung.
(c) Nachgeschaltet: Wer moralisch lebt, der hat kurz- und mittelfristig nicht unbedingt Vorteile durch sein Verhalten. Ehrlichkeit zahlt sich nicht immer aus; wer nicht lügen und betrügen will, hat oft kaum Karrierechancen. Auch im Privaten, in Beziehungsfragen und in der Familie sind konsequent moralisch lebende Menschen nicht immer die Gewinner. Kant hat deshalb einen Ausgleich durch einen ewigen Richter im ewigen Leben postuliert - wir Christen wissen von der Zusage dieses Gottes: Derjenige, der uneigennützig gut handelt, wird nicht leer ausgehen. Es lohnt sich langfristig immer, das als gut Erkannte auch zu tun - und das nicht nur im Hinblick auf das kommende Leben.
Moral ist keine religiöse Erfindung und keine willkürliche Setzung durch Gott oder Kirche. Moral bezeichnet die gelungene Existenz des Menschen und den Weg dorthin. Dennoch ist eine rechte Moral Anliegen jeder Religion und der katholischen Kirche: Sie eröffnet immer wieder die Erkenntnis der moralisch bedeutsamen Wirklichkeit, sie vermittelt die nötige Gnade, um die erkannten Ziele zu verwirklichen und sie verheißt ewigen Lohn denen, deren Leben in Gott vollendet wird.
Wenn es darum geht zu erkennen, was denn getan werden und was man lieber unterlassen sollte, dann hängt eine solche Überlegung davon ab, welches Ziel erreicht werden soll. Ich kann also fragen, ob eine bestimmte Strategie (z.B. die Wahrheit zu verschweigen) zum gewünschten Ziel führt. In diesem Falle würde ich also als gut bezeichnen, dass die richtige Wahl der Mittel in Hinblick auf ein bestimmtes Ziel getroffen wird. (Zum Beispiel: »Ist es hilfreich, alle Armeen dieser Welt abzuschaffen, wenn ich einen umfassenden Weltfrieden erreichen möchte?«)
Ich könnte mir aber auch die Frage stellen, ob ein bestimmtes Ziel überhaupt erstrebenswert ist. Manche sparen alles, was sie haben, für ein superteures Auto, andere für eine Urlaubsreise zum Mond und wieder andere für den Bau eines Krankenhauses in Afrika. Was davon ist gut? Was ist besser? Ich stelle also nicht die Frage nach den richtigen Mitteln, sondern nach der Wahl des Zieles. Wobei ich damit immer auch verbinde, dass es für Menschen verschiedene »letzte Ziele« geben kann.
Eine Handlung kann aber auch in sich gut sein. Das Leben eines Menschen zu retten, ist zum Beispiel nicht nur gut im Hinblick auf ein bestimmtes Ziel (»Erhaltung der menschlichen Art« - oder »Erlangung der Lebensretter-Medaille in Gold«), sondern einfach eine gute Tat, selbst dann, wenn der Gerettete sich nachher als Serienmörder entpuppt. Gut waren an dieser Handlung nicht Ziel oder Mittel, sondern gut war die Haltung des Handelnden; sie hat die Tat zu einer in sich guten Tat werden lassen.
Robert Spaemann gibt dazu ein einleuchtendes Beispiel: Maximilian Kolbe hat im KZ Auschwitz anstelle eines Familienvaters die Todesstrafe auf sich genommen und starb 14 Tage später im Hungerbunker. Nun wird sicherlich keiner behaupten wollen, dass dieses eine zwar für den Familienvater gute Tat war, für Maximilian Kolbe dagegen eine schlechte. Vielmehr wird die Tat sinnvoll nur mit »an sich gut« bewertet.
a. Relativismus. - Nun gibt es unterschiedliche philosophische Konzepte, die beschreiben, wie man zur Bestimmung von gut und böse gelangt. So gibt es zum Beispiel Theoretiker, die behaupten, dass gut und böse immer relativ seien: Was des einen Freud' ist des anderen Leid. So ist gut für den Dieb, reiche Beute zu machen - und schlecht für den Bestohlenen, der nun ärmer ist als zuvor. Solche Philosophen nennen wir Relativisten. Gut und Böse sei immer relativ, je nachdem aus welcher Sicht man schaut.
Wir wollen diese Konzepte nicht alle diskutieren - dazu fehlt hier die Zeit. Gegen den Relativismus lässt sich argumentativ nur schwer angehen. Die Erfahrung des Menschen sieht allerdings dagegen: Wenn jemand sein Leben riskiert und verliert, um jemand anderem das Leben zu retten, sagen wir ja auch nicht, dass die Handlung für den Geretteten gut war, aber aus Sicht des Retters böse.
b. Positivismus. â Andere sind der gleichen Meinung, gehen aber davon aus, dass ein Gesetzgeber festlegt, was gut und böse ist (weil es die Einzelnen ja jeweils anders sehen). Wenn also Diebstahl unabhängig von Kultur und Gesetz weder gut noch böse ist, sondern erst durch einen Gesetzgeber dazu erklärt werden muss, sprechen wir von Positivismus. (Das hat nichts mit »positiv und negativ« zu tun. Der Begriff »Positivismus« leitet sich vom lateinischen ponere = setzen, stellen, legen ab. Der Positivist glaubt also, es ist nur das gut (und böse), was von einer entsprechenden Autorität festgelegt, festgesetzt oder als Gesetz aufgestellt wird.)
Positivisten sind deshalb schwer mit Argumenten zu überzeugen, weil sie im Grunde gar nicht argumentieren. Es ist egal, wieviel Argumente für oder gegen eine moralische Ansicht sprechen: Entscheidend ist allein, ob etwas verboten oder erlaubt ist. Punktum. (Deshalb ist diese Theorie bei Fundamentalisten sehr beliebt - und bei ein wenig unterbelichteten Zeitgenossen, die sich das Selber-Denken gar nicht erst angewöhnt haben: »Wo steht, dass das verboten ist? Also!«)
Relativisten und Positivisten scheinen einander entgegengesetzt zu sein; während der Positivist ständig nach den Vorschriften fragt, überlässt der Relativist die Frage nach gut und böse dem Geschmack des einzelnen. Dennoch ist beiden gemeinsam, dass sie eine Diskussion über die Wirklichkeit mit dem gesunden Menschenverstand für unnötig halten. Sie glauben nicht, dass so etwas wie »gut« und »böse« in der Wirklichkeit und über alle Zeiten hinweg existiert.
c. Utilitarismus. â Andere wiederum glauben schon, dass es gute und schlechte Taten unabhängig von Gesetz und Geschmack gibt - und zwar, indem sie auf die Folgen einer Tat schauen. Die Handlung selber ist eben nur eine Handlung - aber sie wird gut oder böse, gewünscht oder zu vermeiden durch die eher positiven oder negativen Folgen. Dieses moralische Konzept nennt sich Utilitarismus - vom lateinischen utilitas: der Nutzen. Manche nennen dieses Konzept auch teleologische Moral - von griechisch telos: das Ziel. Die Handlung erhält also ihren moralischen Wert durch das Ziel, auf das sie gerichtet ist; dieses Ziel sollte bestenfalls für alle von der Handlung Betroffenen optimal sein.
Das Problem dieser Richtung der Moralphilosophie besteht in der Einschätzung, wann eine Folge optimal ist - und ob man unerwünschte Folgen gegen die gewünschten Folgen aufrechnen darf. Ob die Anzahl der positiven Folgen oder die Qualität entscheidend ist. Ob damit alle Folgen gemeint sind, die eine Handlung jemals haben wird - oder nur die vorhersehbaren oder die unmittebaren... und so weiter. Peter Singer zum Beispiel meint, dass man nur die Präferenzen der Betroffenen gegeneinander rechnen darf; Kleinkinder und Schnecken dürfen daher getötet werden, da sie keine anderen Präferenzen (sprich: Pläne) hätten, als schmerzfrei zu leben.
Neben diesen grundlegenden Konzepten gibt es noch weitere moralische Strategien (meist als Variationen zu den genannten), die alle etwas gemeinsam haben: In bestimmten Bereichen haben sie durchaus ihre Gültigkeit - aber sie taugen nicht zu einer allgemeinen Moral.
So ist die Regelung des Straßenverkehrs weitestgehend positivistisch: Gut und böse handelt jeweils der, der sich an die Regeln hält oder sie verletzt. Linksfahren ist an sich nicht von Übel (die Briten sind deshalb ja auch keine schlechteren Mensch oder Autofahrer); dennoch ist es böse, vorsätzlich in Deutschland links zu fahren.
Tatsächlich sind zahlreiche Gebote und Gesetze tatsächlich kulturbedingt - so z.B. das Tragen bestimmter Kleidungen in der Öffentlichkeit oder die Definition dessen, was als Beleidigung angesehen wird.
Zudem sind die meisten unserer alltäglichen Entscheidungen moralisch irrelevant: Ob ich nun links oder rechts um den Baum herum gehe, ist weder von Übel noch von Nutzen, vermutlich ist auch die Frage, ob ich das Ei an der spitzen oder runden Seite aufschlage, moralisch gleichgültig. Das mag jeder so machen, wie er lustig ist.
Ebenfalls gilt, dass ich bei folgenreichen Entscheidungen die Konsequenzen bedenke und versuche, sie gegeneinander abzuwägen. Ob ich mein Geld für einen Urlaub verwende oder damit das Studium meines Kindes finanzieren möchte, das eventuell gar nicht studieren will, dafür aber meine Frau aber dringend Urlaub braucht, ich aber gerade jetzt in der Firma nicht fehlen kann... Alles das werde ich selbstverständlich bedenken, wenn ich mich entscheide. Wenn möglich, werde ich so handeln, dass die Folgen für möglichst viele Menschen (für mich, mein Kind und meine Frau und meine Firma) angenehm und wünschenswert sind.
Aber selbst in den Bereichen, in denen wir zunächst positivistisch (relativistisch - utilitaristisch - etc.) handeln, setzt uns eine allgemeine Moral Grenzen: Im Straßenverkehr regeln die Gesetze, wie schnell ich fahren darf; dennoch dürfte es leichtsinnig oder gar verwerflich sein, mit der erlaubten Geschwindigkeit in eine Schafherde zu rasen. Und auch, wenn es meine ganz persönliche moralische Entscheidung ist, wie ich mich kleide, kann es unmoralisch sein, auf einem schwarz-afrikanischen Beerdigungskaffee in der Kleidung des Ku-Klux-Klans zu erscheinen.
Und auch der Utilitarismus hat seine Grenzen: So darf ich den im Wartezimmer eines Arztes sitzenden Ehemann einer Patientin nicht einfach töten und seine Organe in 22 dem Tode geweihte Personen verpflanzen, selbst wenn ich nur einen Menschen töte und dafür 22 anderen das Leben rette (und auch dann nicht, wenn der nette Ehemann sich freiwillig dazu bereiterklärt!). - Ebenfalls darf ich nicht auf Experten hören, die mir sagen, dass ich während einer Versuchsreihe einen anderen Menschen ruhig quälen dürfe: ich würde damit die Wissenschaft enorm voranbringen. - Selbst Experten, die mehr Folgen überblicken, als ich es tue, entbinden mich nicht von meiner Verantwortung. - Auch einem Erpresser, der von mir einen Mord an Unschuldigen fordert, darf ich nicht nachgeben, auch dann nicht, wenn er droht, ansonsten den Mord selbst zu begehen und darüber hinaus noch zahlreiche weitere. - Es ließen sich leicht noch viele weitere Beispiele finden.
Jedes vorläufige moralische Konzept kommt an eine absolute Grenze, die wir das »Naturrecht« nennen. Dieses Naturrecht gilt für alle Menschen, zu allen Zeiten und in allen Kulturen und setzt den oft sehr unterschiedlichen lokalen oder zeitbedingten Bräuchen eine moralische Grenze. So ist zu keiner Zeit Vergewaltigung, Mord oder Folter erlaubt, selbst wenn es die Mehrheit einer Gesellschaft praktiziert oder die Gesetze eines (Unrechts-)Staates es erlauben. Ein Teil dieses Naturrechts findet sich in den Menschenrechten wieder, die gerade deshalb formuliert wurden: Weil kein Staat sie durch Gesetze (gegen den Positivismus) oder durch persönliche Vorlieben (gegen den Relativismus) oder in besonderen Notlagen (gegen den Utilitarimus) außer Kraft setzen kann.
Dieses naturrechtliche Konzept behauptet nun nicht, dass »gut« und »böse« natürliche Eigenschaften der Wirklichkeit sind, die es zu entdecken gibt, wie man z.B. Mikroorganismen entdeckt. Moral bleibt eine Beurteilung, die nur dem Menschen gelingen kann - Tiere sind nicht moralisch, d.h. sie unterscheiden nicht zwischen gut und böse - ebensowenig tun das Naturereignisse wie Erdbeben, Überschwemmungen oder Eiszeiten.
Nein, letztlich sind nur die Handlungen der Menschen gut oder böse - die Grenzen dessen, was wir tun dürfen, werden von den Menschen erkannt. Wohlgemerkt: Nicht gemacht, nicht festgelegt, nicht gefühlt - sondern erkannt. Weil dem Menschen die eigene Natur vorgegeben ist und er entweder im Einklang mit ihr handeln kann - oder im Widerstreit dazu.
So ist der Mensch ein Wesen, das eine Sprache besitzt, die wahrheitsfähig ist. Aus dem Wesen der Sprache und der Bedeutung der Wahrheit für den Menschen ergibt sich das Verbot der Lüge. Weder das siebte Gebot der Bibel noch eine Übereinkunft von Menschen machen eine Lüge zur Untat, sondern das Wesen der Sprache und des Menschen lässt eine Handlung, die sich gegen sie richtet, zu einer sinnwidrigen Handlung werden.
Nicht aufgrund von Geboten wird die Sexualität zu einer Sprache der Liebe und der Beziehung, sondern aufgrund der menschlichen Natur. Wer sich also sexueller Mittel bedient, um Macht auszuüben und Unterwerfung einzufordern, verstößt nicht gegen ein kulturelles Gesetz, sondern gegen die Würde der Person.
Nicht aufgrund von staatlichen Übereinkünften ist die Folter, die einen Menschen zu einer Handlung zwingen will, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, sondern weil die Würde des Menschen in der Freiheit seiner Person begründet ist. Wer dem Menschen seine innere Freiheit zerstört (oder es auch nur versucht), versündigt sich am Menschen.
Natürlich bedarf das Naturrechts-Konzept der ständigen Diskussion und Vertiefung. Manche lehnen es gerade deshalb ab: weil es innerhalb dieses Konzeptes unterschiedliche Ansichten und Schulen gibt. Da ist natürlich der Positivismus einfacher (solange man nur in einem Land lebt - und die Gesetze dort widerspruchsfrei sind). Aber: Erstens ist kein einziges moralisches System so homogen, dass es nicht auch unterschiedliche Vertreter gibt; und zweitens ist ja auch in der Mathematik das Phänomen, dass trotz einheitlicher Logik verschiedene Personen zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen (zumindest an meiner Schule passiert das in Mathearbeiten regelmäßig - mit fast schon statistischer Sicherheit), kein Grund, an der Eindeutigkeit der Mathematik zu zweifeln.
Ich möchte hier anhand weniger, aber hoffentlich aussagekräftiger Beispiele die Anwendung des bisher Gesagten aufzeigen. Besonders brisant wird eine moralische Entscheidung, wenn zwischen genau zwei Möglichkeiten entschieden werden muss - die klassische Dilemma-Situation. Dabei kann es sein, dass beide Möglichkeiten sehr erstrebenswert sind, aber nur eine davon realisiert werden kann. Noch bedrängender ist es, wenn zwei Übel gegeneinander abgewogen werden müssen.
a. Zwischen zwei Hoffnungen - zwischen zwei Übeln. â In diese Dilemma-Situationen gerät jeder Mensch immer wieder - ob in mehr oder weniger banalen Alltagssituationen oder aber in tragischen Lebensentscheidungen. Vielleicht liegt hierin sogar das Grundanliegen der Moral, die dann um Rat gefragt wird: Welche Möglichkeiten darf - soll - oder muss ich wählen? Und welche eben nicht?
Gehe ich heute zum Friseur - oder bringe ich mein Auto zur Reparatur? Für beides habe ich heute nicht genug Zeit.
Kaufe ich mir eine Eigentumswohnung oder wohne ich lieber zur Miete? Beides hat Vorteile - aber es lässt sich nicht beides zugleich erreichen.
Enttäusche ich einen alten Freund, der mich auf einen Besuch eingeladen hat und gehe früh ins Bett und schlafe endlich mal aus? Oder ist es besser, übermüdet beim Freund aufzutauchen, anstatt wegen des schlechten Gewissens sowieso nicht einschlafen zu können?
Solche Entscheidungen sind drängend und können unsere Nerven ganz schön strapazieren. Moralphilosophische Konzepte helfen hier nur bedingt weiter, weil die Alternativen in dem Grad ihrer Pflicht oder Güte nicht so einzuschätzen sind, dass wir sie gegeneinander ausrechnen können.
Auch die Moraltheologie hilft hier nicht in jedem Fall weiter. Zu einer wirklichen moralischen Frage wird ein solches Dilemma erst, wenn es eine eindeutige Pflicht (oder ein absolutes Verbot) gibt, eine der beiden Möglichkeiten zu wählen.
Ein absolutes Verbot: So steht vielleicht der lang ersehnte Urlaub gegen die Geburt eines Kindes. Eine Abtreibung ermöglicht den Urlaub; die Geburt des Kindes dagegen verhindert die dringend benötigte Erholung. - Für uns Christen ist klar: Die Tötung eines unschuldigen Kindes ist niemals erlaubt.
Eine eindeutige Pflicht: Ich könnte bei einem Spaziergang dem im See Ertrinkenden zuhilfe eilen - oder lieber auf meine Kinder am Ufer aufpassen, die sich eventuell ängstigen könnten, falls ich ebenfalls in den See springe. - Die Rettung eines Ertrinkenden ist eine unbedingte Pflicht.
Dabei gibt es eine bemerkenswerte Ungleichheit zwischen Verbot und Pflicht: Von einem absoluten Verbot gibt es keine Ausnahmen - es gilt immer. Gute Taten, zu denen ich verpflichtet bin, sind aber nicht immer und unter allen Umständen gut; es gibt durchaus Situationen, in denen eine Tat, die unter bestimmten Umständen von mir gefordert ist, unter anderen Umständen besser unterlassen wird.
So bin ich verpflichtet, den Ertrinkenden zu retten, wenn mich nur meine Sorge um mögliche Alpträume meiner Kinder davon abhält. Wenn ich aber an einer Herzschwäche leide und zudem ein anderer bereits in die Fluten steigt, wäre die versuchte Rettung aus dem See eher unbedachtes Heldentum.
Die Unterscheidung, ob es sich um eine Wahl zwischen zwei Gütern oder zwei Übeln handelt, ist dabei manchmal nur theoretisch. Denn der Verzicht auf das nichtgewählte Gut kann sehr wohl ein enormes Übel sein. Falls zum Beispiel auf der einen Seite ein unbedingtes Verbot steht - auf der anderen Seite eine eindeutige Pflicht, so hat das absolute Verbot (einer in sich schlechten Handlung) immer Vorrang.
Falls ein Terrorist Deine Familie kidnappt und droht, sie zu ermorden, es sei denn, Du begehst Deinerseits einen Mordanschlag auf den Präsidenten, dann scheint Leben gegen Leben zu stehen (das würde der Utilitarist zumindest so sehen). Allerdings darf nicht nur auf das Ergebnis geschaut werden (wieviel Menschen sterben, je nachdem, wie ich mich entscheide?). Wer Pflicht und Verbot richtig gegeneinander abwägt, kommt zwar zu einer höchst tragischen, aber eindeutigen Entscheidung: Du darfst niemals einen unschuldigen Menschen direkt töten! - Eine Ermordung der Kanzlerin kommt also nicht in Frage. Die Ermordung Deiner Familie dagegen ist nicht Deine Tat und nicht Deine Schuld, sondern die Tat eines anderen und dessen Schuld.
b. Güterabwägungen mit Nebenwirkungen. â Ebenfalls wichtig ist es, zwischen einem direkt angestrebten Ziel und einer ungewollten Nebenwirkung zu unterscheiden.
In der Moralphilosophie hat sich dabei das Beispiel der auf Bahngleisen spielenden Kinder etabliert, die von einem heranrollenden Eisenbahnwagon getötet werden könnten. Würde ich nun einen dicken Mann von einer Brücke stoßen, damit er den Wagon zum Entgleisen bringt (und dabei stirbt), würde ich zwar viele Kinder retten - aber einen unschuldigen Menschen dazu benutzen. Nicht nur die christliche Moral verbietet dieses, auch das natürliche Moralempfinden der Mehrheit aller Menschen (ganz gleich, welchen Alters und welcher Kultur) sieht dies ebenso.
Das schaut aber anders aus, wenn ich einen schweren Felsblock auf die Gleise rollen könnte, der den Wagon aufhält und die spielenden Kinder so rettet - und der Felsblock auf seinem Weg auf die Gleise einen (von mir aus wiederum dicken) Mann überrollt. Denn der Tod des Mannes ist in diesem Fall eine (fatale) Nebenwirkung, denn er ist weder beabsichtigt noch notwendig, um die Kinder zu retten. Der Mann wird nicht benutzt und sein Tod ist nicht gewollt.
Das gleiche gilt übrigens für die deutlich realitätsnähere Frage, ob es erlaubt sei, ein vollbesetztes, entführtes Passagierflugzeug abzuschießen, das in einen Wolkenkratzer gelenkt wird. Da ich das Flugzeug auch dann abschießen würde, wenn es unbemannt ist, ist der Tod der Passagiere nicht gewollt, sondern nur in Kauf genommen.
Bei der moralischen Bewertung von Handlungen ist genau zu unterscheiden, ob eine Konsequenz wesentlicher Bestandteil der Handlung ist - oder eine unerwünschte Konsequenz. Dazu hilft es, sich zu fragen, ob die Handlung immer noch gewollt wäre, wenn diese Konsequenz vermieden werden könnte.
Wer zum Beispiel Verbrechen verhindern will, indem er einen verurteilten Mörder hinrichtet, kann sich nicht herausreden, der Tod des Mörders sei nur eine unerwünschte Nebenwirkung seiner Handlung - immerhin wolle er ja nur das Wohl der Mitbürger. Denn auf die Frage, ob er der Hinrichtung auch dann zustimmen würde, wenn der Mörder dabei nicht stirbt, muss er ja wohl mit »nein« antworten. Der Tod des Mörders ist ein wesentlicher Bestandteil der Handlung.
Habe ich aber sichergestellt, dass ich in meiner Entscheidung absolute Verbote und eindeutige Pflichten ausreichend berücksichtigt habe, muss ich die sich nun bietenden Folgen auf ihre Angemessenheit hin überprüfen.
So darf ich nicht einen auf den Gleisen spielenden dicken Mann retten, indem ich einen Felsblock auf den Wagon fallen lasse, in dem sich 30 schlafende Kinder befinden. - Die ungewollten Konsequenzen müssen sich schon in etwa die Waage halten mit den angestrebten positiven Zielen. In den Fällen, in denen ich nach der Angemessenheit der Folgen frage, darf ich sehr wohl utilitaristisch denken und die Folgen in ihren Qualitäten und Quantitäten gegeneinander abwägen. Auch das kann noch zur Qual werden und weitere Überlegungen notwendig machen.
c. Echte Tragik. â Es gibt sie - die echte Tragik. Egal, was ich von den sich mir bietenden Optionen wähle: Es wird immer schrecklich.
Ein erschütterndes Beispiel bietet der Kurzspielfilm »Most« (»Brücke«), in der ein Brückenwärter vor der Wahl steht, eine Eisenbahnbrücke herabzulassen und dadurch seinen Sohn zu töten (der beim Spielen in das Räderwerk der Brücke gefallen ist), oder die Brücke oben zu lassen und dadurch den herannahenden vollbesetzten Zug entgleisen zu lassen.
Ebenso dramatisch ist die Not der Menschen in einem überfüllten Rettungsboot angesichts eines Schiffsunglückes auf hoher See: Werden weitere Passagiere aufgenommen, wird das kleine Rettungsboot sinken, und alle ertrinken. Wehrt man dagegen weitere Hilfesuchende ab, so liefert man diese dem Tod aus.
Nicht alle Fälle lassen sich lösen - einige nur aufgrund des beschränkten Raumes in dieser Katechese, einige aber auch grundsätzlich nicht. Selbst wenn wir eine Bewertung der Optionen vornehmen können, lässt sich die Dramatik einer solchen Situation kaum mildern.
Der Brückenwärter wird, egal wie er sich entscheidet, ein Leben lang Schreckliches vor Augen haben; ebenso die Überlebenden des Schiffsunglückes, die auf Kosten anderer gerettet wurden.
Aber zusätzlich zu einer traumatischen Belastung muss nicht unbedingt auch noch die Schuld kommen. Ein Dilemma, in dem ich auf jeden Fall schuldig werde - egal wie ich mich entscheide - gibt es nicht. Nicht aus christlicher Sicht: Ich kann oft dem Leid oder dem Unglück nicht ausweichen; aber ich muss niemals schuldig werden.
Es gibt aber sehr wohl Dilemmas, die mich - egal wie ich mich entscheide - zu einem gebrochenen Menschen machen können. Die Tragik solcher Situationen liegt nicht in der unausweichlichen Schuld, sondern in der unausweichlichen Katastrophe.
Weit verbreitete moralische Konzepte (wie z.B. der Utilitarismus, der Positivismus oder der Relativismus) sind nur in klar umrissenen Situationen hilfreich und gültig. Das umfassende moralische Konzept ist jedoch das Naturrecht, das auch den anderen Konzepte ihren jeweiligen Gültigkeitsbereich zuweist.
a. Religiöse Moral - im engeren Sinne. â Natürlich gibt es moralische Vorstellungen, die nur innerhalb einer Religion gelten - wie zum Beispiel die Fastenregelungen, der Festtagskalender oder ein Bilderverbot. In der katholischen Kirche sind das darüberhinaus die Zölibatsregelung, liturgische Vorschriften und religiöse Pflichten, wie sie zum Beispiel in den fünf Kirchengeboten festgehalten sind. Ein großer Teil des CIC (Codex Iuris Canonici), also des Kirchenrechtes, gilt nur für Mitglieder der katholischen Kirche - ja, sogar nur für die Mitglieder der lateinischen katholischen Kirche (und eben nicht für die griechisch-, serbisch- oder russisch-katholischen Konfessionen).
Auch die Zehn Gebote sind nicht allesamt allgemeingültig: Die ersten drei Gebote (keine anderen Götter, kein Missbrauch des Gottesnamens und das Sabbat-Gebot) sind nur für die abrahamitischen Religionen verpflichtend (also für die Juden, die Christen und den Islam); selbstverständlich darf ein Hindu auch weiterhin mehrere Götter verehren, und ein Atheist keinen.
Das schließt ein, dass die religiösen Eigenheiten von Mitgliedern anderer Religionen respektiert und unter Umständen sogar geschützt werden sollten, solange nicht (zum Beispiel durch religiösen Fanatismus) die Rechte anderer eingeschränkt werden.
Jeder Staat soll also nicht deshalb religiöse Gebote oder moralische Vorstellungen in eigene, staatliche Gesetze überführen, weil eine Religion sie auf Gott zurückführt. Der Staatsmann ist vielmehr verpflichtet, selbst die Zehn Gebote auf das zu befragen, was vom Staat garantiert werden muss.
b. Durch Offenbarung erkanntes Naturrecht. â Dabei darf dann aber nicht übersehen werden, dass im Gegensatz zu den rein kirchlichen Geboten wiederum andere Gebote, die von den Kirchen vertreten werden, einen allgemeingültigen Anspruch haben. So ist das Verbot der Abtreibung nicht auf eine religiöse Vorstellung zurückzuführen, sondern auf das Naturrecht - und das gilt für alle Menschen. In einer solchen Behauptung liegt natürlich viel Konfliktpotential, denn nicht-religiöse Menschen sind oft auch Agnostiker, Atheisten oder gar Materialisten - und eine materialistische Moral (soweit es sie geben kann) kommt zu allen möglichen Ergebnissen; darunter sind die meisten nicht sonderlich hilfreich. Besonders viel Zündstoff liegt in dem Anspruch der katholischen Kirche, dass ihre Sexualmoral ebenfalls kein katholisches Sondergut ist, sondern ebenso wie das Tötungsverbot zum Naturrecht gehört. Das muss natürlich begründet werden - und darin liegt die Aufgabe der (katholischen) Vertreter der Naturrechtslehre. Die katholische Sexualmoral darf aber auch nicht allein deshalb abgelehnt werden, weil sie in religiösen Kreisen gelebt wird; vor allem ist eine gesetzliche Verordnung, die diese Sexualmoral im Namen der Toleranz auf den religiösen Raum beschränkt und sich einer Argumentation entzieht, selbst intolerant. Es ist eine mitunter mühsame Pflicht der Laizisten, sich der Argumentation der Naturrechtsphilosophen zu stellen und nicht zu entziehen.
c. Strafe, Gesetz und Verbot. â Vornehmlich ist die Moraltheologie beschreibend: Sie begründet und behauptet, dass bestimmte Handlungen gefordert und andere wiederum zu unterlassen sind. Es ist zunächst Aufgabe des Staates und nicht der Religion, die Fehlhandlungen entsprechend zu sanktionieren, um dadurch das Verhalten der Menschen zu lenken. (Eine solche Trennung von Staat und Religion ist allerdings neu und wäre noch vor 250 Jahren auf Unverständnis gestoßen; bis heute denken z.B. die Piusbrüder immer noch in einer Einheit von Staat und Religion). Der Religion obliegt die Aufgabe, durch Argumente, Predigt und Beispiel zur Lenkung, Bildung und Erziehung der Menschen beizutragen - ihre Strafen bestehen maximal darin, dass Mitglieder der Religionen ihre religiösen Rechte verlieren bzw. aus der Religion ausgeschlossen werden.
Seit den Anfängen des Christentum bis ins Mittelalter hat es eine klare Trennung von staatlicher und kirchlicher Gewalt nicht gegeben hat. So konnte es vorkommen, dass auch das Vernachlässigen von religiösen Pflichten, die eigentlich nur für Mitglieder der Religion gedacht waren, mit Gefängnisstrafen geahndet wurden. Mittlerweile haben die katholische Kirche, ihr Rechtssystem, ihre Mitglieder und die Theologie in dieser Hinsicht deutliche Entwicklungen hinter sich; andere Religionen haben diese dagegen noch vor sich.
Wie auch in der Erziehung allgemein, gelingt eine Pädagogik zwar am besten, wenn Verhaltensregeln erklärt und begründet werden, aber selbst bei allerbester Begründung kommen weder Eltern, Lehrer noch Pädagogen ohne Sanktionen aus. Es ist leider nur ein frommer Wunsch, dass Menschen sich so verhalten, wie sie es mithilfe ihrer Vernunft erkannt haben. Leider sind Menschen (jeder Altersstufe und Bildungsschicht) oft genug unvernünftig; vor allem in ihren Taten. So ist der Ruf nach staatlicher Unterstützung der Kirchen in ihrem Kampf gegen die Sünde zwar verständlich; wahrscheinlich ist es aber dennoch ein Segen, dass die Kirche gezwungen ist, sich auf die Verkündigung zu beschränken und diese zu intensivieren. Gottseidank ist es der Kirche nicht mehr möglich, in ihren Reihen Strafen zu verhängen, die nach der Säkularisierung nur dem Staat zukommen.
a. Missverstanden: Moral als Heilsvoraussetzung. â »Allerdings«, so sagen einige, »besitzt die Kirche im Gegensatz zum Staat die ultimative Strafandrohung. Eine unendlich Hölle als Strafe für die Verfehlung des Menschen hat der Staat nicht zu bieten.«
Da ist es wieder - das moderne Zerrbild der Kirche, die nichts anderes tut, als mit der Hölle zu drohen und dadurch ihre Schäfchen gefügig und willig zu machen, um sie schließlich für ihre eigenen Zwecke (Macht, Geld und Missbrauch) zu schröpfen. Wer einmal dieses Zerrbild hat, der wird alles, was die Kirche verkündet, vor diesem Hintergrund sehen: Jesus am Kreuz ist die ultimative Drohung, die Beichte ein Kontrollinstrument des machtgierigen Klerus, der Ablass die monetäre Melkstation der irdischen Schäfchen und eine Papst-Audienz eine Veranstaltung zur Massenhypnose. - Wer einmal mit einem solchen Blick auf die Kirche schaut, sieht sich überall bestätigt. Was aber vor allem an dem Wahrnehmungsfilter liegt.
Dieser Blick auf Kirche und Religion kommt nicht von ungefähr. Ihm zugrunde liegt die Vorstellung, Moral wäre eine Zugangsbedingung zum Himmel: In den Himmel kommen nur diejenigen, die sich an die moralischen Normen halten. Das hätten - so der scheinbar naheliegende Gedanke - die Mächtigen der Kirche ausgenutzt, um diesen moralischen Zugangsbedingungen klammheimlich eigene Vorstellungen hinzuzufügen: Also spricht der hinterlistige Pfarrer: »Nur wer Vater und Mutter ehrt, kommt in den Himmel...? Na, das können wir flugs erweitern: Wer Vater, Mutter und den eigenen Pastor ehrt und vor allem letzterem den zehnten Teil seiner Einkünfte zukommen lässt, kommt in den Himmel... Macht sich auch stilistisch besser, gell?«
Wie auch immer: Jede derartige Karikatur der katholischen Kirche und Moral fallen in sich zusammen, weil moralisches Verhalten eben keine Zugangsbedingung für den Himmel ist. Auch »rechter Glaube« (die nächste karikaturhafte Unterstellung) ist nicht alleingültige Eintrittskarte fürs Paradies. Entscheidend sind vielmehr: Gottesbeziehung; Sehnsucht nach Erbarmen, Vergebung und Erlösung; Vertrauen auf die Barmherzigkeit Gottes und Vertrauen auf die Versöhnung, erworben durch Jesus am Kreuz. Im Himmel werden wir angesichts der Herrlichkeit Gottes vor allem gefragt: »Willst Du das?«
Nicht, wer sich moralisch wohlverhält, ist heilig. Ganz im Gegenteil: Charles Peguy hat gesagt, das gefährliche an der Moral sei, dass sie wie eine Schutzschicht gegen die Gnade wirke.
b. Recht verstanden: Moral als Wahrnehmung. â Wenn aber nicht der, der alles (oder möglichst vieles) richtig gemacht hat, das ewige Leben gewinnt, sondern der, der gelernt hat, die Gnade Gottes anzunehmen, dann stellt sich die Frage, welche Rolle die Moral in der christlichen Religion spielt. Welchen Zweck erfüllt die Moraltheologie in der christlichen Religion? Nun, die Antwort ist überraschend: Keinen.
Moral dient keinem Zweck. Moral ist schlicht eine Erkenntnis der Wirklichkeit (über Normen, die einen Anspruch an unsere Freiheit und unser Handeln stellen). Wir fragen ja auch nicht, welchen Zweck die Erkenntnis oder das Gefühl oder der Verstand hat: Wir nehmen sie wahr, weil sie existieren. Auch die Moral ist keine bloße Erfüllungsgehilfin für einen bestimmten Zweck - weder dient sie dem Machterhalt der Kirche, noch dem Eintreten in die himmlische Herrlichkeit. Sie beschreibt schlicht, wie die Wirklichkeit beschaffen ist und wie eine Handlungsweise aussieht, die diese Realität berücksichtigt und in Freundschaft mit ihr bleibt.
Unsere evangelikalen Freunde sind der Meinung, dass Moral (und vor allem die Zehn Gebote) der Frustration des Menschen dienen, damit sie nach Erkennen des eigenen moralischen Unvermögens ihre Zuflucht bei Gott suchen.
Wir Katholiken glauben, dass die Zehn Gebote eine Art Ehevertrag zwischen Gott und seinem Volk darstellen: Einen Bund. Gott verspricht, in Freundschaft mit seinem Volk zu bleiben - und sein Volk verspricht, in Freundschaft mit Gott, mit seiner Schöpfung und mit mir selbst zu leben. Auf diese Freundschaft kommt es an. Nennen wir es ruhig »Liebe« und den Bund am Sinai eine Art »Gott-Mensch-Ehebund«. Wichtig ist: Unser Eintrittskarte in den Himmel ist Gott. Nicht die Moral. Ein Hochzeitspaar heiratet schließlich auch nicht die Liebe - sondern den Geliebten. Die Moral beschreibt das, was zwischen den Liebenden existiert, wenn alles in Ordnung ist. Aber um alles in Ordnung zu bringen, müssen wir den Blick auf den Geliebten richten - nicht auf die Moral.
c. Hilfreich: Moral als Eselsbrücke. â Im Paradies haben wir keine Moral und keine Gesetze gebraucht; im Himmel wird es ebenso sein. In der Zwischenzeit -hier auf Erden- können Gebote dagegen sehr hilfreich sein. Denn während Adam und Eva einander noch ungetrübt und liebend vor Augen hatten und glasklar war, wie die Liebe zu leben war, fehlt uns heute manchmal der (moralische) Durchblick und der ungetrübte Blick auf den zu liebenden Menschen. Während Adam das Büchlein »Zehn Regeln, wie man seine Partnerin nicht enttäuscht« noch nicht brauchte, fehlt uns heute manchmal der Sensus für die »Basics der Beziehungspflege«. Moral schafft Klarheit. Moral ist eine Eselsbrücke.
Aber es fehlt gelegentlich nicht nur der Sensus für das, was wir tun sollen, um zu lieben. Manchmal fehlt sogar die Fähigkeit, überhaupt etwas zu lieben. Gottseidank sind die meisten Menschen nur phasenweise so in sich gekrümmt. Um aus solchen Phasen wieder zurück zur wahren Freude (der Beziehungsfreude) zu gelangen, gibt es den Ratgeber »Wie Du falsche Freuden (Ersatzdrogen) von echter Erfüllung unterscheiden kannst - und der Weg dorthin«. Untertitel: »Der katholische Glaube«. - Moral ist ein wesentliches Kapitel dieses Ratgebers. Eine Eselsbrücke.
Vielleicht hast Du aber auch alles richtig erkannt: Das, was Dich und den Geliebten glücklich macht (in wahren Liebesbeziehungen gibt es darin keinen wesentlichen Unterschied) - und den Weg dorthin. Was dann manchmal noch fehlt, ist die Kraft, diesen Weg auch zu gehen. (Wir wissen alle, dass Übergewicht schlecht ist. Und wir wissen, dass Sport eine gute Sache ist, um das Übergewicht zu reduzieren. Aber wir haben einfach keine Lust). - Hier wird die Moral (also die Eselsbrücke, die es mir leichter macht, das Gute und den Weg dorthin im Blick zu behalten) durch die Gnade ergänzt, die eine Kombination aus Rückenwind und Möhre ist. Der Wind schiebt von hinten und die Möhre lockt den Esel von vorne.
Wenn Du Esel dann auf dem Weg zum Guten irgendwann Fahrt aufgenommen hast, die Gnade in Dir wächst, Du das Gute immer klarer vor Augen hast und Du in einem fort erfährst, wie schön es ist, zu lieben: Dann brauchst Du immer weniger Eselsbrücken und immer weniger Moral. Irgendwann reichen Rückenwind und Möhre.
Ungeübten Denkern scheint es manchmal so, als ob die Art und Weise der Argumentation in der Moral willkürlich verändert worden sei. Normalerweise hat derjenige, der eine These aufstellt, auch die Beweispflicht. Zwei konkurrierende Behauptungen werden danach abgewogen, wer bessere, plausiblere und einleuchtendere Argumente vorzuweisen hat.
Aber wer erkannt hat, dass die Moralphilosophie eine Weise der Erkenntnis der Wirklichkeit ist, erkennt sehr schnell, dass sie auch in der Frage der Beweisbarkeit und der Beweislast keinen Sonderweg geht. Denn es gilt:
Wir können nicht beweisen, dass etwas existiert oder ob alles vielleicht eine Illusion (oder eine Simulation à la »Matrix«) ist. Zunächst schenken wir also dem, was wir sehen, erfahren und hören, unser Vertrauen. Allerdings wissen wir, dass es Täuschungen gibt (nicht nur optische Täuschungen, sondern Wahrnehmungsverzerrungen der verschiedensten Art), weswegen wir jedem, der uns auf eine Täuschung hinweisen will, größte Aufmerksamkeit schulden. Seine Argumente gilt es gut und klug zu erwägen - nur so können wir ja unsere eigenen Wirklichkeitsvorstellungen hinterfragen.
Es wäre allerdings Unsinn, wenn wir einem fundamentalen Skeptiker die Wahrnehmung der Wirklichkeit beweisen müssten. Das ist schlechterdings unmöglich. Die Beweislast liegt bei dem, der das Offensichtliche bestreitet. »Das Offensichtliche« ist ein philosophischer Begriff: das »Evidente«, das »nicht beweisbar ist, aber auch keines Beweises bedarf«.
Das Gleiche gilt für die Moral:
Wir können nicht beweisen, dass es so etwas wie »gut« und »böse« gibt - oder ob alles vielleicht eine Illusion (oder eine Simulation à la »Matrix«) ist. Zunächst schenken wir also dem, was wir sehen, erfahren und hören, unser Vertrauen. Allerdings wissen wir, dass es Täuschungen gibt (nicht nur optische Täuschungen, sondern Wahrnehmungsverzerrungen der verschiedensten Art), weswegen wir jedem, der uns auf eine Täuschung hinweisen will, größte Aufmerksamkeit schulden. Seine Argumente gilt es gut und klug zu erwägen - nur so können wir ja unsere eigenen Moralvorstellungen hinterfragen.
Es wäre allerdings Unsinn, wenn wir einem fundamentalen Skeptiker das, was wir als »gut« erkannt haben, beweisen müssten. Das ist schlechterdings unmöglich. Die Beweislast liegt vielmehr bei dem, der das Offensichtliche bestreitet. »Das Offensichtliche« sind in der Moralphilosophie die überlieferten Werte; das »Evidente«, das »nicht beweisbar ist, aber auch keines Beweises bedarf«.
So lässt sich kaum erweisen, warum es schlecht sein soll, Menschen zu essen (vorausgesetzt, sie sind tot). Dennoch ist diese Moralvorstellung klar überliefert. Nun sind wir unter Umständen bereit, diesen moralischen Wert aufzugeben, wenn jemand uns die Unhaltbarkeit dieser Norm aufzeigt. (Wie es die Überlebenden eines Flugzeugabsturzes in den Anden getan haben. Siehe dazu den Roman und Film »Überleben«). Die Begründungspflicht hat aber nicht der, der sich weigert, sondern der, der ein überkommenes Werturteil aufheben will.
Dieses Vertrauen in die grundlegenden Werte kommt nicht von ungefähr. Jeder Mensch entwickelt aufgrund seiner Anlagen eine moralische Intuition, so wie sich auch die Fähigkeiten eines Menschen entwickeln, sich selbst zu schützen. Wenn jemand am eigenen Leib erfährt, wie schmerzlich ein Rippenstoß oder ein Vertrauensbruch ist, wird er beides zukünftig vermeiden. Er wird verhindern, solches zu erleiden - aber auch, anderen solches zuzufügen; denn die Fähigkeit, im anderen Menschen seinesgleichen zu erkennen und ihn vor dem zu bewahren, was auch mir selbst Leid bereitet, prägt sich bereits im Kleinkindalter aus.
Die Frage, warum sich einzelne Menschen von dieser Erkenntnis wieder frei machen können - wie es kaltblütige Gewalttäter offensichtlich getan haben -, und ob es ein aktives »Niederlegen der Moral« überhaupt gibt, können wir hier leider nicht beantworten. Überhaupt ist das Fehlen von Moral bei einzelnen Menschen ein seltsames Phänomen und sicherlich schwer zu begründen; das belegt aber auch nur, dass der Normalfall das Vorhandensein von Moral ist.
Die katholische Kirche ist - auch wenn es nicht so wahrgenommen wird - sehr dankbar für Kritik an Normen, die »seit jeher so gehandhabt wurden«. Die Versuchung, Werte nur deshalb zu befolgen, weil jemand sie formuliert hat, ist groß - aber nicht gesund. Auch nicht für die Kirche und die Religion. Besser ist es, wenn wir verstehen und selbst erkennen.
Dass die Religionen für eine religionsinterne Moral (z.B. für Kultvorschriften) eigene Normen aufstellen dürfen, mag unbestritten sein. Für die allgemeingültige Moral wird der Kirche und jeder Religion die Zuständigkeit abgesprochen. Tatsächlich ist die Kirche sowohl Augenöffner für die universell gültige Moral, als auch Motivationsgrund und begleitende Gnade für das rechte Verhalten in Staat und Welt. Vorbehalte dagegen gibt es viele - nicht erst, um den Anspruch der Kirche abzuwehren, sondern schon bei der Behauptung, es gebe so etwas wie eine »universale Moral«.