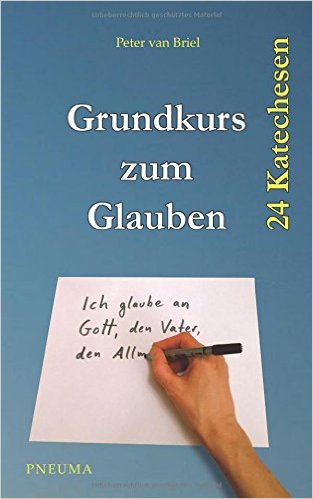Neue Site - empfehlenswert! Ein Ableger der Karl-Leisner-Jugend: aktueller, kürzer, frischer und moderner: www.gut-katholisch.de.
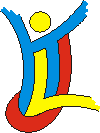 |
KARL-LEISNER-JUGEND |
Grundkurs des Glaubens - Aussagen über Gott |
| I. Die Erkenntnis der Vernunft | ||
| 1. Von Aristoteles zur Scholastik: die Transzendentalien | ||
| 2. Thomas von Aquin und Duns Scotus: die Analogie des Seins | ||
| 3. Kant und Spaemann: Gott als Postulat | ||
| II. Das Zeugnis das Alten Testamentes | ||
| 1. Genesis und Exodus | ||
| a. Die Theologie des Schöpfungsberichtes | ||
| b. Die Theologie des Exodus | ||
| c. Die Theologie des Sinai-Bundes | ||
| 2. Das grausame Gottesbild | ||
| a. Die Geschichte des Volkes Israel ist theologisch interpretiert | ||
| b. Die Theologie des Alten Testamentes hat sich entfaltet | ||
| c. Gott ist Pädagoge | ||
| 3. Vorausdeutungen auf die Dreifaltigkeit | ||
| a. Gott spricht zu sich im Plural | ||
| b. Der Engel Gottes - der Jahwe-Engel - wird mit Gott identifiziert | ||
| c. Die göttliche Weisheit | ||
| III. Das Zeugnis des Neuen Testamentes: der dreifaltige Gott | ||
| 1. Herleitung: Wie kommt man nur auf so etwas wie »Dreifaltigkeit«? | ||
| a. Mehr als nur eine Person | ||
| b. Aber nicht mehr als nur ein Gott! | ||
| c. Wer ist der Vater? | ||
| 2. Konsequenzen: Was es bedeutet, einen dreifaltigen Gott zu haben | ||
| a. Gott ist Geschehen | ||
| b. Das Band der Liebe: Gott ist Familie | ||
| 3. Denkerische Stolperfallen | ||
| a. Gott als Vater anreden? | ||
| b. Die Geistvergessenheit | ||
| c. Ist das nicht unvernünftig? | ||
Die christliche Offenbarung ist nicht durch vernünftige und logische Folgerung zu ersetzten - kein Mensch käme von sich aus auf Erkenntnisse des Glaubens wie die Dreifaltigkeit (Trinität), die Menschwerdung Gottes (Inkarnation) oder Erlösung des Menschen durch den Kreuzestod (Soteriologie). Dennoch halten wir fest, dass die natürliche Vernunft nicht nur die Gottes Existenz erkennen kann (darüber haben wir an den ersten 3 Abenden der Fundamentaltheologie nachgedacht), sondern auch ansatzweise, wie dieser Gott ist.
a. Anaxagoras (499-428 v. Chr.) â erkannte aus den Naturdingen eine geistige Vorstellung der Gottheit. Er schließt aus der Ordnung der Welt auf eine bewusste, tatkräftige Macht höherer Art, einen immateriellen »ungemischten und leidenslosen« Geist (besser: ein geistiges Wesen), das »unendlich und selbstbeherrschend ist und durch sich selber lebt«. Noch war der Begriff der »Person« nicht weiter entfaltet (das geschah erst durch den Einfluss der Christologie - siehe 8. Abend), aber nach Anaxagoras besitzt dieses göttliche Wesen »Willen und Macht, es hat alles angeordnet, was war, was ist und was sein wird«. (S.A. Ryk, Die vorsokratische Philosophie I 191/245).
b. Sokrates und Platon. â (1) Sokrates (469-399 v. Chr.) hinterlässt uns zwar selbst keine Schriften, musste aber für seine selbsterworbene reine Gotteserkenntnis als »Märtyrer der Wahrheit« den Schierlingsbecher (einen Giftbecher) trinken.
(2) Platon (428-347 v. Chr.) hat im Anschluss an Sokrates einen Gottesbegriff entwickelt, der bis heute das christliche Denken beeinflusst. »Für ihn ist Gott die Idee des Guten in sich, der Sinn allen Erdenlebens ist es, diesem Inbegriff des Guten nachzustreben. Als Weltbildner hat er die zwar ewige, aber gestaltlose Materie hinblickend auf die ewigen Ideen geformt und gestaltet.« Nach Platon müssen wir uns diesen Gott als frei von allen Fehlern denken, dafür aber ausgerüstet mit allen Vollkommenheiten (z.B. Allwissenheit und Allmacht). Platon ging sogar so weit zu fordern, dass die Verkündiger atheistischer Lehren mit einer längeren Haft zu bestrafen seien, während der Heft sei dem Häftling religiöser Unterricht zu erteilen - im Wiederholungsfall gebühre ihm die Todesstrafe.
c. Aristoteles (384-322 v. Chr.) war in seiner philosophischen Gotteserkenntnis derart weit fortgeschritten, so dass er von der mittelalterlichen Theologie sogar als »Vorläufer des Christentum« bezeichnet wird. Im zwölften Buch der Metaphysik entwirft er seine Gotteslehre, demnach Gott nicht nur »abstrakter Verstand, nicht bloße physische Grund- oder Urkraft, nicht schlechthin nur der unbewegte Beweger« ist. Aristoteles preist mit geradezu religiöser Begeisterung: »In der Gottheit ist Leben, denn des Geistes Tätigkeit ist Leben und der Geist ist Tätigkeit. Reine und absolute Tätigkeit ist ihr bestes Leben. So sagen wir also, dass Gott sei ein lebendiges, ewiges, bestes Wesen. Leben kommt ihm zu und stetige, ewige Dauer« (Metaphysik, 12. Buch, c.7). Cicero zitiert eine ansonsten verloren gegangene Stelle des Aristoteles, in der er sich vorstellt, dass Menschen, die ein Leben lang in einer licht- und freudlosen Unterwelt gefangen gehalten wurden, eines Tages an die Oberwelt - also unsere Lebenswelt - gelangen. »Fürwahr, wenn diese Menschen dann mit einem Mal das Land, die Meere, den Himmel erblickten, wenn sie gewahr würden die Größe der Wolken und die Gewalt der Winde, ansichtig würden der Sonne mit ihrer großartigen Herrlichkeit und allerleuchtenden, den Tag heraufführenden Wirkung⦠- ja fürwahr, die müssten doch an die Gottheit und an das Geschaffensein aller dieser Werke von ihr glauben.« (Cicero, De natura Deorum, II 37).
Diesem kleinen Einblick in die vorchristliche Philosophie können wir getrost entnehmen, dass die Aussage des Römerbriefes über die natürliche Erkennbarkeit Gottes eine reale Verwirklichung in den größten Philosophen des Altertums gefunden hat: »Denn was man von Gott erkennen kann, ist ihnen offenbar; Gott hat es ihnen offenbart. Seit Erschaffung der Welt wird seine unsichtbare Wirklichkeit an den Werken der Schöpfung mit der Vernunft wahrgenommen, seine ewige Macht und Gottheit.« (Röm 1,19f)
Dass Philosophen (und auch Naturwissenschaftler, Geistes- und Gesellschaftslehrer aller Zeiten) ohne die christliche Offenbarung, allein aufgrund der Naturbeobachtung und des klugen Nachdenkens zum Schluss zu einer Gottesvorstellung kommen, wirft die Frage auf, auf welche Weise dies geschieht. Nun, die Wege sind sehr vielfältig (siehe dazu z.B. ![]() »Hinweise auf die Existenz Gottes«, hier seien lediglich drei vorgestellt:
»Hinweise auf die Existenz Gottes«, hier seien lediglich drei vorgestellt:
a. Die Transzendentalien. â Transzendentalien sind »das allen Seienden Gemeinsame«, da sie von allem ausgesagt werden können. In Hinsicht auf das, was gewusst werden kann, sind sie die ersten Begriffe, da sie nicht auf logisch Vorausgehendes rückführbar sind. Zu den antiken Transzendentalien bei Aristoteles gehört neben dem Sein (ens) das Eine (unum), in der Scholastik wurden auch das Wahre (verum), das Gute (bonum) und später auch das Schöne (pulchrum) als allem Sein gemeinsam erkannt, zudem die Andersheit (aliquid) und das Wesen (res).
Da es sich dabei um »das allen Seienden Gemeinsame« handelt, ist damit auch Gott umschrieben, der - insofern er existiert - gut, schön, wahr, eins und zugleich anders sein muss. Ein Geschaffenes ist immer auch in seinem Sein und somit auch in seiner Schönheit / Wahrheit / Einheit etc. eingeschränkt. Gott aber muss auch in seinen Transzendentalien vollkommen sein, sonst wäre er nicht Gott.
Gott ist also der absolut Gute, Schöne und Eine. Eine Mehr-Gottheit wäre als sowohl für Aristoteles und im Nachgang für die mittelalterliche Scholastik ein Widerspruch in sich - ebenso ein böser Gott oder ein hässlicher Gott.
b. Die Geistigkeit. â Ein unvoreingenommener Blick auf die eigene menschliche Existenz lässt schnell erkennen, dass der Mensch Eigenschaften hat, die sich nicht aus der Materie ableiten lassen können. Sie sind kein Produkt der materiellen Welt, da sie geistiger Qualität sind. Demnach müssen diese Ergebnis eines göttlichen Schöpfungsaktes sein (so der Schluss der meisten Philosophen), dann lässt sich durch diese Eigenschaften auch auf den Schöpfer zurück schließen. Wenn der Mensch an sich beispielsweise Freiheit entdeckt (nicht nur eine Freiheit, dies oder das zu wählen, sondern eine Freiheit, sich selbst zu gestalten, zu entwerfen und sogar sich verneinend zu seinem eigenen Menschsein zu verhalten), so muss der Urheber dieser Freiheit selbst frei sein. Gott muss also der in-sich-frei-Seiende sein. Gleichzeitig ist der Mensch fähig, Gut und Böse zu erkennen und seine Freiheit daran auszurichten; obwohl Gut und Böse keine Begriffe sind, die sich materiell begründen lassen. Daraus lässt sich unmittelbar schließen, dass Gott der absolut Gute ist und die Freiheit Gottes eine voll und ganz am Guten ausgerichtete.
Auf diese Weise lässt sich viel mehr über das Wesen Gottes sicher erkennen, als wir, bereits von der christlichen Offenbarung erleuchtet, vielleicht vermutet haben. Das liegt vielleicht daran, dass in vielen Naturreligionen selten das »absolut Gute« verehrt, sondern viel häufiger das dämonisch-Hässliche gefürchtet wird. Das darf uns aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass gerade in diesen Religionen das Gute ersehnt und erwartet wird - weshalb die christliche Mission oft offene Türen bei den Naturvölkern dieser Welt vorgefunden hat.
c. Das Gewissen. â Zu den Quellen der natürlichen Gotteserkenntnis hat neben der sichtbaren Welt immer auch das Gewissen gezählt. So stellt Alois Riedmann (in »Die Wahrheit des Christentums«) als erste These auf: »Sowohl aus der sichtbaren Welt, die uns umgibt, als aus der Stimme des Gewissens, das sich in uns regt, haben die Menschen, die sich ehrlich um Gott bemühten, zu jeglicher Zeit und hinreichend erkannt, dass es einen überweltlichen Gott gibt«. (Die Wahrheit des Christentums, Bd. I, S. 5). Dabei ist es nicht nur das, was die Stimme des Gewissens uns sagt, sondern vielmehr, dass sie überhaupt vorhanden ist und sich nicht unterdrücken lässt, untrügliches Zeichen für die Existenz Gottes und Seiner Güte. Gerade das Gewissen macht uns zu geistigen Personen, die permanent an ihre Freiheit erinnert werden und auch bei Menschen, die sich ihrer Freiheit zunehmend entledigen, umso lauter darauf verweist. Der Inhalt der Gewissensstimme ist darüber hinaus geeignet, zahlreiche weitere Eigenschaften Gottes klarer zu fassen: Ehrlichkeit, Lauterkeit, zugleich Größe und Feinheit, Macht und Zärtlichkeit - usw.
Natürlich müssen wir unser Gewissen bilden; es ist durchaus abhängig von Kultur und Erziehung. Aber es ist dem Menschen erstens nicht möglich, kein Gewissen zu haben; ebensowenig kann ein Mensch frei und eigenständig über sein Gewissen verfügen und z.B. ein Verhalten »per inneren Beschluss« als rechtmäßig zu etikettieren.
a. Thomas von Aquin: Die Ähnlichkeit des Seins / des Seienden (Analogia entis). â Für die philosophische Erkenntnis Gottes, ja für jede Aussage über Gott gilt nach Thomas von Aquin (1225-1274): Gott ist nicht im gleichen Sinne »gut« wie wir es von einem Menschen sagen wollen. Gott ist in einem noch viel umfassenderen Sinn »gut«, als es Handlungen, Gedanken oder Worte sein können. Von Gott kann also in menschlichen Begriffen immer nur in analoge Art und Weise gesprochen werden - analog ist hier nicht der Gegenbegriff zu »digital«, sondern als »Ähnlichkeit« (Analogie) zu verstehen (Gottes Schönheit und die Schönheit eines Sonnenunterganges haben also eine gewisse Ähnlichkeit). Allerdings ist die Unähnlichkeit in jeder Aussage über Gott verglichen mit einer Aussage über etwas Diesseitiges um ein Unendliches größer als die Ähnlichkeit.
Die Analogie ist aber nicht nur eine Einschränkung der Redeweise über Gott, sondern ein eigenständiger Weg der Gotteserkenntnis. Denn in allem, was wir in dieser Welt als gut, schön, wahr usw. erkennen, erkennen wir auch ein wenig über Gott. Das ist deshalb so, weil Gott das »subsistierende Sein« selbst ist, das Übrige hat an diesem Sein teil. Dieses Teilhabeverhältnis (ähnlich dem platonischen Partizipationsverhältnis) ist eine wesentliche Bedingung und der Grund für die philosophische Erkenntnis des Transzendenten. Die »Analogia entis« (die Ähnlichkeit allen Seins) führt uns so auf einem natürlichen Weg zu einer Ahnung, wie Gott ist.
Thomas kennt noch zwei weitere Wege, Gott zu erkennen und von Ihm zu sprechen. Der Weg der Verneinung (via negativa) kann zum Beispiel klar sagen, was Gott nicht ist. Was dem Wesen Gottes widerspricht, kann keine Eigenschaft Gottes sein - so können wir sehr viel besser, sicher und häufiger sagen, was Gott alles nicht ist. Zugleich ist auch der Via negativa ein Weg der Gotteserkenntnis, indem wir Gott zum Beispiel als den Un-endlichen, dem Un-begreiflichen und dem Un-bedingtem.
Als dritter Weg bleibt die via eminentiae. Gottes Wesen übersteigt alles Erfahrbare und Vorstellbare; wenn wir also die Sprache von Gott ins Unermessliche steigern, dann treffen wir auch das Wesen Gottes (irgendwie). Zum Beispiel ist Gott nicht bloß mächtig - er ist vielmehr allmächtig - ebenso wie aus Wissen die Allwissenheit und aus Güte die Allgüte Gottes wird. Im Allgemeinen werden die drei Viae als Redeweisen von Gott aufgefasst - von Gott könne man also nur analog, über die Verneinung oder die Übersteigerung sprechen. Zugleich sind diese Viae aber auch Erkenntniswege.
b. Duns Scotus: Die modalen Formen. â Duns Scotus (1266-1308), der einige Jahre nach Thomas von Aquin lebte und (obwohl er deutlich weniger bekannt ist) ein mindestens ebenbürtiger Denker der Scholastik war, verstand die Transzendentalien als noch klarere Aussagen über Gott, die der reinen Vernunft möglich sind. So sei Gott im gleichen Sinne »gut«, »wahr« und »eins« wie es auch für die geschaffene Wirklichkeit ausgesagt werden kann (dazu wird im allgemeinen das Wort »univok« verwendet); allerdings sei Gott von der geschaffenen Wirklichkeit modal unterschieden: Gott und Mensch sind univok gut, Gott ist allerdings unendlich gut, der Mensch nur endlich; Gott sei notwendig gut, der Mensch besitze dagegen die Möglichkeit der Güte. Zu den modalen Formen gehört neben der Unendlichkeit-Endlichkeit und der Notwendigkeit-Möglichkeit auch die Einheit-Vielheit.
c. Immanuel Kant: Das Postulat. â Immanuel Kant (1724-1804) dagegen lehnte eine natürliche Erkenntnis Gottes weitestgehend ab - für ihn gab es keinen Weg von dem Wissen über diese Welt zum Wissen von oder über Gott. Allerdings taucht Gott in der Kantischen Philosophie als Postulat auf. In seinen drei berühmten Postulaten fordert Kant die Existenz von Freiheit, ewigem Leben und Gott - eben, weil er diese drei nicht logisch ableiten kann:
Wer seine sittliche Aufgabe erfüllen soll, der muss auch frei sein. Ein Mensch, der nicht frei ist, kann für sein Tun nicht zur Verantwortung gezogen werden. Die Freiheit ist also ein Postulat der Sittlichkeit.
Das Sittengesetz verlangt vom Menschen eine Heiligkeit des Wollens. Diese ist aber in unserem kurzen Leben unerreichbar. Es muss daher eine Unsterblichkeit geben, in der sich der Mensch dem Ideal der Vollkommenheit nähert. Die Unsterblichkeit ist also ein Postulat, das sich aus der Sittlichkeit der Freiheit ergibt.
Die Tugend verlangt Lohn, das Laster Strafe. Von einem gerechten Ausgleich kann auf dieser Welt keine Rede sein. Es muss daher einen Gott geben, der diesen Ausgleich herbeiführen wird. Gott ist also ein Postulat, das sich aus der Sinnhaftigkeit der Sittlichkeit ergibt.
Demzufolge ist Gott Garant der Gerechtigkeit, also gerechter Richter, Helfer der Entrechteten und Strafer der Lasterhaften. Aus Kants Gottes-Postulat lässt sich nicht nur die Existenz Gottes, sondern notwendig auch wesentliches über seine Eigenschaften ableiten.
Zur Erkenntnis der Existenz Gottes kommen Denker und Philosophen aller Zeiten und Kulturen; auch wesentliche Aussagen darüber, wie denn dieser Gott beschaffen ist, sind ansatzweise möglich. Doch ohne die Selbstoffenbarung bleibt diese Erkenntnis blutleer und lädt nicht zur gelebten Gottesbeziehung ein.
Die Erkenntnisse der reinen Vernunft über die Existenz und das Wesen Gottes sind zwar relativ sicher. Paulus spricht von der Erkenntnis in seinem Brief an die Römer: »Denn was man von Gott erkennen kann, ist ihnen offenbar; Gott hat es ihnen offenbart. Seit Erschaffung der Welt wird seine unsichtbare Wirklichkeit an den Werken der Schöpfung mit der Vernunft wahrgenommen, seine ewige Macht und Gottheit. Daher sind sie unentschuldbar. Denn sie haben Gott erkannt, ihn aber nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt. Sie verfielen in ihrem Denken der Nichtigkeit, und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Sie behaupteten, weise zu sein, und wurden zu Toren. Sie vertauschten die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes mit Bildern, die einen vergänglichen Menschen und fliegende, vierfüßige und kriechende Tiere darstellen.« (Röm 1,19-23)
Dennoch sind sie weiter von unserem christlichem Gottesbild entfernt, als wir gelegentlich annehmen. Uns ist der personale Gott auch aus den anderen großen Religionen so sehr vertraut, dass wir dies stillschweigend als einzig-mögliche Gottesvorstellung verstehen. Dass jemand von Gott spricht und damit nur eine unpersönliche Kraft meint, scheint uns völlig abwegig.
Daraus resultieren zumindest zwei Schwierigkeiten: Zum einen sind die Gottesbeweise nicht in der Lage, unser christlich-jüdisches (und auch islamisches) Gottesverständnis zu begründen; deshalb lehnen viele jeden Gottesbeweis als völlig unzureichend ab. Dass ein Beweis der reinen (d.h. nicht von einer Offenbarung ergänzten) Vernunft gar keinen solchen personalen Gott erweisen kann, sondern eben nur zu einem allgemeinen philosophischen Gottesbegriff führen kann - dieses aber durchaus zuverlässig - wird dann oft nicht mehr wahrgenommen.
Die andere Schwierigkeit führt uns nun zum nächsten Kapitel: Die Offenbarung Gottes im Alten Testamentes wird immer wieder auf dem Hintergrund der christlichen und spät-jüdischen Gotteserkenntnis als ziemlich rückständig erlebt. Ein Gott, der sich als Kriegergott offenbart, wird nicht nur als dem heutigen Glauben unangemessen betrachtet, sondern sogar als dem wahren Gott entgegengesetzt begriffen. Dieses Missverständnis entsteht, wenn wir die Anfänge der Offenbarung mit den Lebensverhältnissen der heutzutage Glaubenden vergleichen. Bedenken wir aber, was für einen Fortschritt allein schon die Offenbarung Gottes als ein dem Menschen zugewandter, persönlicher Gott im Vergleich zur blutleeren philosophischen Erkenntnis eines »unbewegten Bewegers« bedeutet, dürfen wir den Stab über die früh-jüdische Offenbarungsgeschichte nicht zu früh brechen.
Natürlich sind die biblischen Bücher nicht in der Reihenfolge niedergeschrieben worden, in der wir sie heute in gedruckter Form finden. Das erste Buch der Bibel (die Genesis) ist also nicht unbedingt das älteste Buch und vielleicht auch jünger als die Exodus-Geschichte. Dennoch dürfen wir davon ausgehen, dass die ersten fünf Bücher (»die Bücher Mose« - für die Juden die »Tora«) zur ältesten Schicht gehören.
a. Die Theologie des Schöpfungsberichtes. â Um so überraschender ist die bereits in den wesentlichen Grundzügen ausgeprägte und klare Theologie, die wir dort finden. Es gibt keinen langsamen Übergang vom Polytheismus (Vielgottglaube) zum Monotheismus (Eingottglaube) oder eine Entwicklung vom mythologischen Gott (wie bei Zeus, Jupiter, Ra oder Odin) hin zum geistigen Gottesbegriff. Alles das ist bereits klar und ausgeprägt in den ersten beiden Kapiteln, den beiden sogenannten Schöpfungserzählungen (die Aussagen des Schöpfungsberichtes haben wir bereits am 2. Abend, Abschnitt III.2 aufgeführt).
Im weiteren Verlauf des Genesis-Buches schließt Gott einen Bund mit Abraham. Allein schon dieser Gedanke sprengt alle bisherigen Gottesbilder der Antike und Vorzeit: Gott ist Bundespartner des Menschen, er ist am Menschen interessiert, er gibt dem Geschöpf eine Verheißung und garantiert selbst die Erfüllung. Wer sich nur ein wenig mit den Gottesbildern in Babylon, Ägypten, Indien und anderen vorzeitlichen Kulturen beschäftigt hat, erkennt, welche ungeheure Revolution bereits in diesen Aussagen steckt.
b. Die Theologie des Exodus. â Noch eindringlicher wird die Selbstoffenbarung Gottes, die im zweiten Buch der Bibel - dem Buch Exodus - vollzogen wird: Die Exodus-Erfahrung ist der Schlüssel zu einem Gottesbild, das nicht aus den Naturgottheiten ableitbar ist - Gott ist radikal anders. Seit der Exodus-Geschichte hat der jüdische - und daran anschließend der christliche und islamische - Glaube ein wesentlich anderes Gottesbild als alle sonstigen Religionen:
Gott ist nur ein einziger Gott, er fürchtet keine anderen Götter; er fürchtet jedoch um die Menschen, die sich falschen Göttern zuwenden.
Gott ist kein lokaler Gott mehr, er wohnt nicht auf einem Berg oder an unzugänglichem Ort - er ist ein dem Menschen zugewandter Gott.
Gott ist der Gott auch fremder Völker; seine Plagen schlagen auch die Ägypter.
Gott hat einen Namen: JHWH - ich bin, der ich bin. Anders übersetzt (»ich bin der, als der ich mich erweisen werde«) verspricht Gott, dass er durch sein Handeln erkannt werden will.
Gott ist ein Freund der Riten und Rituale - er ordnet selbst Feste und Gottesdienste an.
Gott will keine Gewalt, ist aber im Notfall zur Gewalt bereit.
Gott will keine Opfer, sondern Gehorsam: Sein Bund besteht aus Gesetzen.
Gott erwählt sich sein Volk - das Volk verdient sich ihren Gott nicht.
Gott ist als Gott kein Gott, der etwas von den Menschen will - er braucht und benötigt die Menschen nicht.
Gott befreit das Volk aus der Hand des Pharao und nimmt dessen Stelle ein
Gott ist König und Herr.
c. Die Theologie des Sinai-Bundes. â Noch einen weiteren Schritt stellt das »Sinai-Geschehen« dar, also der Bundesschluss mit den Zehn Geboten als »Bundesvertrag«. Gott will nicht in erster Linie Macht und Opfer, sondern das Wohl seines Volkes. Die Gebote 4-10 (zur konfessionell unterschiedlichen Zählweise der Gebote kommen wir am 13. Abend) beziehen sich ausschließlich auf das Verhalten der Menschen zueinander. Selbst die ersten drei Gebote, die scheinbar Gottes Anspruch auf die im gebührende Ehre sichern, sind zum Wohl des Volkes formuliert: Letztlich schaden Vielgötterei, Missbrauch Gottes und Gottlosigkeit dem Menschen, nicht Gott selbst.
Wie jeder Bund bedeutet der Sinai-Bund gegenseitiges Versprechen (einen Vertrag): Gott verspricht sich, sein Handeln und seine Treue dem von ihm auserwählten Volk; dafür hält sich das Volk an die Gebote. Die Gebote sind aber keine Gott darzubringenden Opfer, sondern ein moralisches Verhalten, das wiederum dem Menschen zugute kommt. Mit anderen Worten: Der Bund am Berg Sinai ist eine selbstlose Zuwendung Gottes zu den Menschen.
Vor allem bedenkenswert sind die letzten beiden Gebote: In Amerika ist es üblich, zur Eheschließung sogenannte »Eheversprechen« in ein kleines Büchlein zu schreiben und es dem Ehepartner feierlich zu überreichen. Darin stehen dann Dinge wie »Ich werde Dich niemals an Deiner Berufsausübung hindern«, »Ich werde niemals Deinen Geburtstag vergessen«, »Ich werde Dir zu Liebe nicht mehr Alkohol trinken, als ich vertrage«, »Ich werde niemals schlecht über Dich reden« - und so weiter. Das ist der tiefere Sinn der Zehn Gebote: Sie sind Eheversprechen. Korrekt übersetzt müssten sie also nicht heißen: »Du sollst⦫, auch nicht »Du wirst⦫, sondern »Weil ich Dich, Gott, liebe, werde ich niemals lügen, niemals stehlen und die Ehe heilig halten; ich werde keinen anderen Gott neben Dir haben, denn ich liebe Dich doch; ich werde Deinen Namen ehren und Deinen Wochentag....« Und nur in diesem Sinne ergeben die beiden letzten Gebote ihren tiefen Sinn. Einem Polizisten-Gott ist es egal, ob wir uns danach sehnen, über die rote Ampel zu fahren - Hauptsache, wir tun es nicht. In einem Eheversprechen ist aber die innere, unsichtbare Gedanken- und Herzenswelt viel wichtiger als das äußerliche Tun: »Weil ich Dich liebe, werde ich auch meine Gedanken hüten und nichts von dem begehren, was Dich traurig macht....«
Der Gedanke, dass der Bundes-Schluss am Sinai dem Ehebund gleicht, ist im Judentum Allgemeingut; für die Juden war die Form des Bundesschlusses immer schon eindeutig als Ehevertrag erkennbar; nur für uns Christen ist diese Erkenntnis mit der Zeit etwas in den Hintergrund geraten.
Wir haben von 46 Büchern des Alten Testamentes gerade einmal die ersten beiden Bücher (Genesis und Exodus) betrachtet. Es wäre ein eigenes mehrbändiges Werk erforderlich, diese Entdeckungsreise nun fortzusetzen. Vor allem bei den Propheten (Jesaja, Hosea und Ezechiel), in den Psalmen und der Weisheitsliteratur finden sich unzählige Elemente, die ein bereits so ausgereiftes Verständnis von Gott und seiner Beziehung zu uns Menschen widerspiegelt, dass die Vermutung, hier hätte sich aus einer philosophischen und mythologischen Anfangssituation ein zunehmend reflektierter Glaube ohne jede Offenbarung entwickelt, absurd ist. Wer Augen hat, die über den Horizont von Christentum und Judentum hinausblicken, wird an der Offenbarung Gottes im Alten Testament keinen Zweifel haben.
Im Zusammenhang mit seiner Kritik an jedem Gottesglauben legt Richard Dawkins (»Der Gotteswahn«) auch ein »Psychogramm« des Gottes des Alten Testamentes vor. Demnach ist Gott »die unangenehmste Gestalt in der gesamten Literatur, eifersüchtig - und noch stolz darauf; ein kleinlicher, ungerechter, nachtragender Überwachungsfanatiker; ein rachsüchtiger, blutrünstiger, ethnischer Säuberer; ein frauenfeindlicher, homophober, rassistischer, Kinder und Völker mordender, ekliger, größenwahnsinniger, sadomasochistischer, launisch-boshafter Tyrann.« (Gotteswahn, S. 45)
Sein Gedankengang ist bestechend einfach: Entweder ist der erste Teil der Bibel wörtlich zu nehmen: Dann wird es schwer für einen demokratischen Zeitgenossen, sämtliche Werte der modernen Gesellschaft zu retten angesichts eines Gottes, der Morde am laufenden Band befiehlt. Oder das Alte Testament ist nur ein metaphorisches Sammelsurium, in dem nach Belieben all das gestrichen werden kann, was unserem heutigen Verständnis von Moral, Gerechtigkeit und Recht widerspricht. Dann kann aber auch Gott selbst gestrichen werden, wenn es dem Denken des modernen Menschen nicht mehr behagt. Wer einmal anfängt zu streichen und zu deuten, der wird nicht aufhören, bis die Bibel schließlich auf dem gleichen Glaubwürdigkeits-Level rangiert wie die Werke der Gebrüder Grimm.
Diese »Entweder - Oder - Falle« (entweder ist die Bibel unmittelbar Gottes Wort - oder ein Märchenbuch) wird nicht nur von Dawkins und anderen Kritikern der Religion aufgestellt, sondern übrigens auch von den evangelikalen, fundamentalistischen Christen. Beiden Gruppen ist es ein Dorn im Auge, dass die katholische Kirche glaubt, einen Mittelweg zwischen den beiden Extremen gefunden zu haben - und ihn zudem noch rational begründet.
Die Vertreter des »Entweder-Oder« haben aber auch ein wenig recht. Denn ein Mittelweg braucht ein vernünftiges Fundament. Man kann nicht einfach nur sagen, dass weder der rechte noch der linke Graben zutreffen, die Grenzen der neuen Gattung müssen nicht einfach nur festgelegt werden, sondern müssen sich aus der Natur der Sache ergeben. Es muss sauber, einleuchtend und logisch nachvollziehbar unterschieden werden:
Die Geschichte des Volkes Israel ist theologisch interpretiert
Die Theologie des Alten Bundes hat sich entwickelt
Gott ist ein Pädagoge
a. Die Geschichte des Volkes Israel ist theologisch interpretiert. â »Früher war alles anders ⦠und alles war besser.« Obwohl wir genau wissen, dass dieser Grundsatz noch niemals gestimmt hat (und uns immer heftig wehren, wenn Oma oder Opa mit dieser Phrase mal wieder das goldene Zeitalter ihrer Jugend heraufbeschwören), denken wir immer noch, dass zu den biblischen Zeiten Gott unmittelbarer in der Welt zugegen war, Wunder häufiger geschahen und Gottes Rede deutlicher vernommen wurde. Dann liegt natürlich der Gedanke nahe, dass die Welt damals auch heiliger war - mit Gott als Hauptakteur. Der Blick ins Alte Testament ernüchtert dann schnell und macht wütend: Wenn Gott doch damals alle Fäden selbst in der Hand hatte, warum ging es dann damals so grausam zu? Was für ein Gott ist das!?!
In diesem Gedankengang (»Früher war Gott präsenter - Früher müsste also alles besser gewesen sein - Das war es aber nicht, im Gegenteil! - Also ist Gott kein guter Gott - Gottseidank hält er sich heutzutage zurück!«) liegt ein Fehler - bereits im ersten Satz. In den biblischen Zeiten war Gott keineswegs aktiver im Weltgeschehen und seine Rede eben nicht klarer zu vernehmen. Im Gegenteil. Tatsächlich dürfte die umgekehrte Aussage zutreffender sein: Bei den geschichtlichen Ereignissen im Alten Testament handelt es sich um die ersten Versuche, sich auf Gott einzulassen.
Das Alte Testament ist in erster Linie ein theologisches Geschichtsbuch über das Volk Israel, über seine Anfänge mit Abraham, Isaak und Jakob und seine oft schrecklichen Erlebnisse im Laufe der Jahrhunderte. Während die unbekannten Schreiber die Geschichte dieses ziemlich kleinen und weltgeschichtlich äußerst unbedeutendem Volkes aufschrieben, haben sie in der Geschichte das Wirken Gottes gesehen - sie haben interpretiert. Dass die Bibel - das Alte und das Neue Testament - eine Interpretation der Wirklichkeit sind, sollte uns nicht verwundern. Denn auch heute noch ist die Geschichtsschreibung - ob im Großen oder im Kleinen - immer auch eine Interpretation. Denn was für jede Wirklichkeit gilt, gilt natürlich auch für die religiöse Wirklichkeit. Jedes Ereignis, das als Wunder bezeichnet wird, setzt eine Interpretation der Wirklichkeit voraus (genauso wie der Leugner des Wunders). Jede »Fügung«, sogar die anerkannten Wunder in Lourdes (genau genommen bedeutet »Anerkennung« nicht anderes als »offizielle Interpretation«) als auch die Wunder des Alten und Neuen Testamentes sind nichts anderes als Interpretationen der Wirklichkeit.
Im Roman »Das Jesus-Video« erzählt Andreas Eschenbach von einem Video, das ein Zeitreisender von Jesus aufgenommen hat. Die Reaktionen auf diese kurzen Szenen sind genial geschildert: Die einen Betrachter sind begeistert von der Art und Weise, wie Jesus geht, lächelt und spricht - sie sind zutiefst angerührt. Die anderen Betrachter sind enttäuscht: Sie sehen nur einen Mann, der durch die Gegend geht. Wie langweilig.
Das, was die Videokamera aufgenommen hat, sind blinde Informationen. Erst im Betrachter entsteht die Wirklichkeit; wobei es in der Freiheit des Menschen liegt, tiefere oder nur oberflächliche Wirklichkeiten zu sehen.
Interpretationen sind jedoch nicht eindeutig - immer sind unterschiedliche Interpretationen möglich. Um die Wirklichkeit angemessen zu verstehen, brauchen wir einen Vor-Begriff, ein Vor-Verständnis für das Wirkliche - einen Schlüssel. Der richtige Schlüssel zum Verständnis der Welt und der Wirklichkeit findet sich nicht nur in der Wirklichkeit selbst. Gerade der Blick des Menschen auf die Wirklichkeit ist seit dem Sündenfall getrübt und nicht mehr eindeutig. Der richtige Schlüssel zum Verständnis der Wirklichkeit kommt von Gott; somit sind wir bei einem Gedanken, der ganz wesentlich ist zum Verständnis des Alten Testamentes: Das, was Gott uns zu sagen hat, wird zunehmend deutlicher, je mehr wir von Gott verstehen.
Das heißt: Die Empfänger (die Menschen des Alten Bundes) müssen erst nach und nach (im Laufe der Jahrhunderte) auf die richtigen Frequenz eingestellt werden (die richtige Interpretation der Wirklichkeit). Haben sie einmal die richtige Frequenz, können sie anfangen, mit dem dort empfangen Wissen auch bessere Empfänger zu bauen. Oder, um es nun endlich in Klartext zu formulieren: Über die gesamte Zeitspanne des Alten Testamentes finden wir eine sich entfaltende Theologie. Sowohl beim Gedanken an Gott (dem Monotheismus), an das Leben nach dem Tod, der Bedeutung der Gebote, der Rituale und des Gottesdienstes bis hin zur Moral - alles das ist nicht von Anfang an fertig und klar gewesen, sondern brauchte viele Jahrhunderte der Reifung und des Lernens.
b. Die Theologie des Alten Testamentes hat sich entfaltet. â Das Alte Testament zeichnet nun diese Entwicklung nach - und liefert uns nicht einfach nur die Ergebnisse. Wer sich allein für das Fazit dieses Dramas zwischen Gott und Menschen interessiert, kann gerne in einem Katechismus oder einer Dogmatik nachschlagen. Dort findet sich die Quintessenz der mühseligen Geschichte. Wenn allerdings davon die Rede ist, dass das Alte Testament eine Entwicklung des Gottesglaubens darstellt, hören einige sofort »Evolution« heraus - und vermuten, dass sich da angeblich etwas von alleine entwickelt hat. Das ist natürlich nicht gemeint, denn, wie wir schon festgestellt haben, waren die wichtigsten Grundgedanken des Judentums sehr früh schon verblüffend klar. Was das aber für Leben, Moral, Gottesdienst und Politik bedeutete - und welche Konsequenzen sich ansonsten noch aus diesen »Basics« ergeben - das musste sich noch entfalten. Im Gegensatz zum Begriff Evolution (»Neues entsteht nach und nach«) bedeutet Entfaltung, dass sich etwas Vorhandenes zunehmend deutlich erkennen lässt.
Diesen Gedanken, dass etwas, das zwar schon vorhanden ist, sich noch weiter entfalten und die Lebenswirklichkeit zunehmend durchdringen muss, findet sich ausdrücklich in der Reich-Gottes-Lehre des Neuen Testamentes wieder - dazu kommen wir am neunten Abend (»Die Verkündigung Jesu«).
c. Gott ist Pädagoge. â Gott ist heilig. Aber das gilt nicht für sein Volk. (Zumindest, wenn wir unter »Heiligkeit« ein Mindestmaß an Vollkommenheit verstehen. Oder zumindest ein gewisses Streben nach Vollkommenheit.) Es gab zwar einmal eine Zeit, als die Menschen genauso heilig waren, wie Gott es sich wünscht - aber dieser paradiesische Zustand ist schon im ersten Kapitel der Bibel zerstört worden. Wir haben das Paradies verloren, und nun gibt es nur noch ein Ziel der Weltgeschichte: Die Menschen wieder zurückzuführen zur ursprünglichen Heiligkeit. Aber das bedeutet gerade, dass Gott sich mit Leuten einlassen muss, die eben nicht Gottes Wege gehen, nicht denken wie er und nicht begreifen, was gut und schön ist.
Natürlich können wir Gott vorwerfen, er mache gemeinsame Sache einem Volk, das sich nicht sonderlich unterscheidet von einer Verbrecherbande.
Jakob betrügt seinen Bruder Esau um sein Erbe und übertrifft sogar noch seinen hinterhältigen Onkel Laban an Verschlagenheit; Mose beginnt seine Karriere als Befreier des Volkes mit einem heimtückischen Mord; David, der König des goldenen Zeitalters, raubt einem einfachen Soldaten zuerst seine Frau und dann dessen Leben. Abraham zweifelt an der Verheißung Gottes, Sarah lacht Gott aus, Lot ist kurz davor, seine eigenen Töchter dem sexuellen Missbrauch freizugeben - und so weiter.
Sie alle haben Dreck am Stecken, Leichen im Keller und sind offensichtlich Sünder. Mal weist Gott ausdrücklich darauf hin, mal wird es nur erwähnt. Aber beschönigt wird es niemals. Denn Gott und sein Volk wissen, woran sie sind: »Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, führen wir uns selbst in die Irre, und die Wahrheit ist nicht in uns.« (1 Joh 1,8)
(Damit sich an dieser Stelle nicht die Juden empören über diese despektierliche Bemerkung: Auch die katholische Kirche bezeichnet sich als das »Volk Gottes«, und wir sind - in dieser Hinsicht - immer noch nicht viel besser.) Aber wenn wir Gott kritisieren, dass er sich mit Sündern einlässt, dann sind wir auch nicht besser als die Pharisäer, die Jesus genau das vorgeworfen haben, als er mit Zöllnern, Prostituierten und Sündern zusammen gegessen hat. Seine Antwort war ganz klar: »Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken«. (k 5,31) Ja, das Volk Gottes besteht aus Sündern, die ziemlich viele ungöttliche Dinge tun. Und Gott muss nun damit leben, dass wir Ihm genau das vorwerfen: Er hat sich ein Volk von Brutalos erwählt. Aber Gott ist bereit, sich die Finger schmutzig zu machen - zumindest nimmt er diesen Vorwurf in kauf.
Aber dieser Vorwurf ist unfair. Natürlich kann man dem Gott des Alten Testamentes das Gleiche vorwerfen wie Jesus, der mit den Sündern isst. Dass er sich lieber fern halten soll von diesem Pack. Aber, das lehrt uns jede Pädagogik: Man kann nur die Menschen ändern, die man liebt und deren Nähe man sucht. Und Gott hat beschlossen, auch den Sünder zu lieben. Gott ist eben der Ur-Pädagoge. Außerdem würden wir uns mit dem Grundsatz »Lieber Gott, lass Dich niemals mit einem Sünder ein, dass ruiniert Deinen Ruf!« auch unserer eigenen Gottesbegegnungen berauben. Denn wir sind auch nicht besser, wir sind auch Sünder, wir sind auch ein verlogenes Pack. Vielleicht verbinden die Gott-Kritiker wie Dawkins mit dem Aufruf »Lass Dich nicht mit Sündern ein!« die Hoffnung, dass Gott sie auch selbst in Ruhe lässt, damit sie weiter darüber schimpfen können, dass Gott einfach ein schmieriger Typ ist, mit dem sie zumindest nichts zu tun haben wollen. Gottseidank hält sich Gott nicht an diese pharisäische Bigotterie.
Dass Gott sich entgegen unserem Rat trotzdem von Anfang an mit uns sündigen Menschen einlässt, bedeutet nicht, dass er auch die Sünde gutheißt. Er stimmt weder den Bosheiten der 12 Söhne des Jakobs zu (z.B. Gen 34), noch dem, was zur Tätigkeit der Prostituierten gehört, wenn Jesus mit ihnen gemeinsam isst. Er liebt die Sünder - nicht das, was sie tun. Aber er brandmarkt nicht als erstes die Sünde - sondern knüpft zunächst eine Beziehung zum Sünder. Denn Gott ist kein Hau-drauf-Pädagoge, der uns durch Strafe zur Einsicht bringen will. Sondern durch Liebe.
Gott führt dieses Volk. Mag sein, dass wir sein pädagogisches Konzept nicht immer verstehen. Aber solange Gott nicht Böses gutheißt und Gutes verurteilt, solange bezieht sich unser Unverständnis Gott gegenüber nur auf seine pädagogische Methode. Und (das weiß jeder Lehrer) in der Pädagogik gehen die Meinungen eben auseinander. So überrascht es auch nicht, dass alle Personen des Alten Bundes Dreck am Stecken haben - eine schon sehr bemerkenswerte Tatsache. Während andere Völker in ihren Sagen und Legenden reine Lichtgestalten erfinden, bleibt die Bibel realistischer - und dem eigentlichen Anliegen Gottes treu. Denn auch die »Auserwählten Gottes«, die berufen sind, das Volk näher zu Gott zu führen, sind Teil des Volkes - und nicht etwas Teil der göttlichen Welt.
Der Gedanke, dass Gott dreifaltig sei - also zwar nur ein Gott, aber in drei Personen - lässt sich nicht im Geringsten aus dem jüdischen Gottesbild ableiten. Für die Juden war kaum etwas ein größeres Gräuel als der Glaube an mehrere Götter. Die Juden wurden zwar permanent wegen ihrer »Götterarmut« von den umliegenden Völkern verspottet, dennoch hielten sie eisern am Monotheismus fest. Dass die Christen ausgerechnet in den Heiligen Schriften der Juden, dem »Alten Testament«, Hinweise auf die Dreifaltigkeit entdecken wollen, ist überraschend - aber auf der anderen Seite auch kaum zu leugnen. Allerdings handelt es sich hier nur um Vorausdeutungen auf die Dreifaltigkeit - als Argument, um Juden und Muslime von der Dreifaltigkeit zu überzeugen, reicht es dann doch nicht:
a. Gott spricht zu sich im Plural
»Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere auf dem Land.« (Gen 1, 26)
Die ersten christlichen Theologen haben in diesem Plural ein Gespräch zwischen Gottvater und dem Sohn und dem Geist gesehen; es kann sich jedoch auch nur um eine Sprachfigur (Selbstgespräch) handeln.
b. Der Engel Gottes - der Jahwe-Engel - wird mit Gott identifiziert
»Da behandelte Sarai sie so hart, dass ihr Hagar davonlief. Der Engel des Herrn fand Hagar an einer Quelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schur. Er sprach: Hagar, Magd Sarais, woher kommst du, und wohin gehst du? Sie antwortete: Ich bin meiner Herrin Sarai davongelaufen. Da sprach der Engel des Herrn zu ihr: Geh zurück zu deiner Herrin, und ertrag ihre harte Behandlung! Der Engel des Herrn sprach zu ihr: Deine Nachkommen will ich so zahlreich machen, dass man sie nicht zählen kann. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Du bist schwanger, du wirst einen Sohn gebären und ihn Ismael (Gott hört) nennen; denn der Herr hat auf dich gehört in deinem Leid⦠- â¦Da nannte sie den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte: El-Roï (Gott, der nach mir schaut). Sie sagte nämlich: Habe ich hier nicht nach dem geschaut, der nach mir schaut?« (Gen 16, 6-16)
Der Text setzt den »Engel des Herrn« mit Gott gleich - zumindest spricht Hagar von einer Begegnung mit Gott. (Ähnliches gilt für zahlreiche weitere Gotteserscheinungen, in denen der Engel des Herrn und Gott selbst nicht deutlich von einander unterscheiden sind). Frühchristliche Theologen erkannten in der Dopplung (Engel - Gott) zwei Personen, die beide Gott sind: Eine, die sendet, und eine, die gesandt wird. Nach Jes 9, 6 und Mal 3, 1 wird der Engel von den Kirchenvätern mit Jesus Christus identifiziert. In einer sehr bekannten anderen »Theophanie« (Gotteserscheinung) werden sogar drei Männer gemeinsam als der eine Gott bezeichnet:
»Der Herr erschien Abraham bei den Eichen von Mamre. Abraham saß zur Zeit der Mittagshitze am Zelteingang. Er blickte auf und sah vor sich drei Männer stehen. Als er sie sah, lief er ihnen vom Zelteingang aus entgegen, warf sich zur Erde nieder⦠- â¦Sie fragten ihn: Wo ist deine Frau Sara? Dort im Zelt, sagte er. Da sprach der Herr:⦠- ⦠Da sprach der Herr zu Abraham: Warum lacht Sara und sagt: Soll ich wirklich noch Kinder bekommen, obwohl ich so alt bin?⦠- ....Die Männer erhoben sich von ihrem Platz und schauten gegen Sodom. Abraham wollte mitgehen, um sie zu verabschieden.« (Gen 18, div. Verse)
c. Die göttliche Weisheit
Beispiel: »Ich, die Weisheit, verweile bei der Klugheit, ich entdecke Erkenntnis und guten Rat. Gottesfurcht verlangt, Böses zu hassen. Hochmut und Hoffart, schlechte Taten und einen verlogenen Mund hasse ich. Bei mir ist Rat und Hilfe; ich bin die Einsicht, bei mir ist Macht. Durch mich regieren die Könige und entscheiden die Machthaber, wie es Recht ist; durch mich versehen die Herrscher ihr Amt, die Vornehmen und alle Verwalter des Rechts.
Ich liebe alle, die mich lieben, und wer mich sucht, der wird mich finden⦠Der Herr hat mich geschaffen im Anfang seiner Wege, vor seinen Werken in der Urzeit; in frühester Zeit wurde ich gebildet, am Anfang, beim Ursprung der Erde. Als die Urmeere noch nicht waren, wurde ich geboren, als es die Quellen noch nicht gab, die wasserreichen. Ehe die Berge eingesenkt wurden, vor den Hügeln wurde ich geboren. Noch hatte er die Erde nicht gemacht und die Fluren und alle Schollen des Festlands. Als er die Fundamente der Erde abmaß, da war ich als geliebtes Kind bei ihm. Ich war seine Freude Tag für Tag und spielte vor ihm allezeit. Ich spielte auf seinem Erdenrund, und meine Freude war es, bei den Menschen zu sein.« (Spr 8, 12-31)
In den Weisheitsbüchern (Sprichwörter, Sirach, Weisheit) wird die göttliche Weisheit als eigene Person neben Jahwe dargestellt; sie ist von Ewigkeit her aus Gott hervorgegangen, wirkt bei der Erschaffung der Welt mit. Die Väter haben darin gerne einen Hinweis (im Lichte des Neuen Testamentes) auf Jesus Christus gesehen.
Im Zeugnis des Alten Testamentes offenbart sich bereits der uns im Christentum vertraute liebende Gott - das wird besonders deutlich im Schöpfungsbericht und dem Bundesschluss am Sinai; aber auch in den Psalmen und Propheten. Dennoch ist das Gottesbild des Alten Testamentes durchsetzt mit zeitbedingten »Verunreinigungen«, die sich erst im Licht des Neuen Testament als solche erkennen lassen.
a. Mehr als nur eine Person. â Unser Glaube ist vernünftig: Bei der großen Aufregung um die Regensburger Vorlesung des Papstes im Herbst 2006 wurde immer wieder das beanstandete Zitat zum Islam erwähnt - aber den eigentlichen Inhalt der Vorlesung hat kaum einer wahrgenommen. In dieser Vorlesung betont Benedikt XVI, dass Gott in sich vernünftig ist. An sein vernünftiges Wesen ist Gott sogar so sehr gebunden, dass er nicht lügen kann, sondern dass er - zum Beispiel - an seine eigenen Verheißungen gebunden ist. Das unterscheidet uns Christen von den Moslems - zumindest von der muslimischen Theologie, die Gott für absolut frei hält und die Freiheit Gottes so weit fasst, dass er wirklich alles kann: Auch (wenn es IHM gefällt) lügen, betrügen und zur Gewalt aufrufen.
Aber: Ist es denn nicht hochgradig unvernünftig, von Gott anzunehmen, dass er zwar nur ein Gott ist, aber trotzdem Vater, Sohn und Heiliger Geist? Drei Personen bedeutet in unserem Alltag auch drei Menschen. Ein Mensch - aber drei Personen - das ist schizophren (oder, wie ein Schüler meinte, trizophen).
So werfen einige Kritiker des christlichen Glaubens - zum Beispiel die Zeugen Jehovas oder auch Muslime - der Kirche vor, sie hätte drei Götter und wäre deshalb eigentlich eine polytheistische Religion. Die Zeugen Jehovas glauben beispielsweise, die Christen hätten den Tritheismus von den Babyloniern übernommen.
Grundsätzlich sollte aber jeder Religion zugestanden werden, dass man sie so versteht, wie ihre eigenen Lehrer und Autoritäten sie darlegen. Und der christliche Glaube hat sich immer als monotheistisch verstanden. Aber die Frage: »Wie soll das denn gehen - drei Personen und nur ein Gott?« müssen die Christen schon irgendwie beantworten. Und vor allem die Frage: »Wie kommt ein vernünftig denkender Mensch auf so etwas?!«
Wieso wir Christen auf die absurde Idee der Dreifaltigkeit gekommen sind? Die Antwort ist einfach: Jesus ist schuld daran. Er hat von sich als Gott gesprochen, immer wieder göttliche Autorität beansprucht und sich an die Stelle des einen Jahwe-Gottes gestellt (dazu mehr in der Jesus-Christus-Katechese). Kein Wunder, dass die streng-monotheistischen Juden ihn schließlich ausmerzen wollten. Aber Jesus war selbst ja auch ein Jude und tief verwurzelt in der jüdischen Tradition. Diese hat vieles in ihrer Geschichte durchgemacht - aber immer (!) daran festgehalten: »Höre, Israel! Jahwe, unser Gott, Jahwe ist einzig!« (Dtn 6,4). Das galt auch für Jesus. Jesus hätte nun sagen können: »Hallo, meine jüdischen Mitbrüder, ich bin es - Euer Gott!« Dann wäre uns viel Denkarbeit erspart geblieben. Denn dann ist es eben Jahwe persönlich, der eine-einzige Gott, der sich zwischenzeitlich auf der Erde aufhielt. Damit wäre die Einzigkeit Gottes und der Anspruch Jesu auf seine eigene Göttlichkeit logisch zu vereinbaren. Aber Jesus hat das nicht getan. Er hat von sich als Gott auf Erden gesprochen und gleichzeitig vom göttlichen Vater im Himmel.
Man könnte ein wenig entnervt nun weiterdenken: Ob wir von zwei Personen (Gottvater und Gottsohn) in einem Gott reden - oder von drei: Das logische Ärgernis bleibt das gleiche. Einer mehr oder weniger - was sollâs⦠Deshalb ist der logische Schritt von der Anerkennung zweier Personen (Gottvater und Gottsohn) zur Trinität (Gott-Vater, -Sohn und Heiliger Geist) nicht mehr so groß. Aber die Christen sind keine Philosophen. Die denken sich nicht einen Glauben logisch aus. Um an eine Dreier-Gottheit zu glauben, musste sie schon auf die Verkündigung Jesu zurückgehen. Für die Christen war aber die Annahme, dass nicht nur Jesus, sondern auch der Heilige Geist eine eigenständige Person neben dem Vater ist (aber es dennoch nur einen Gott gibt), nicht eine nachträgliche Erweiterung. Auch wenn in der Bibel vom Heiligen Geist nicht in dem Maße geredet wird, wie Jesus von sich selbst als Gott Zeugnis ablegt: Jesus muss wohl in dem, was nicht aufgeschrieben wurde, so deutlich vom Heiligen Geist als eigenständige Person gesprochen haben, dass von Anfang an klar war: Drei - oder keiner!
Für diesen Glauben sind die ersten Christen bereitwillig in den Tod gegangen, so auch der erste Märtyrer Stephanus - Apg 7,51 (»Heiliger Geist«) und Apg 7,55f (»Jesus«).
Eindeutig ist auch die trinitarische Formel am Ende des Matthäus-Evangeliums: »Darum geht zu allen Völkern, und macht alle Menschen zu meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes« (Mt 28,19)
b. Aber nicht mehr als nur ein Gott! â Wenn wir betonen, dass Gott nur ein Gott ist, dann verschwimmt schnell die Eigenständigkeit der Personen - um das zu vermeiden hatten die Christen der ersten Jahrhunderte alle Hände voll zu tun. Wir müssen uns aber auch vor dem anderen Extrem hüten - aus dem einen Gott drei Götter zu machen. Auch wenn die Fachbegriffe ähnlich klingen: Trinität (für Dreifaltigkeit) und Tritheismus (für drei Götter) oder Trias (für alle sonstigen Dreiheiten). Denn die Christen stehen so sehr in der Tradition der jüdischen Offenbarung, dass wir von der Selbstaussage Gottes nichts zurücknehmen: »Höre, Israel! Jahwe, unser Gott, Jahwe ist einzig. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Diese Worte, auf die ich dich heute verpflichte, sollen auf deinem Herzen geschrieben stehen.« (Dtn 6, 4-6). Aber nicht nur, weil die Juden den Christen den Ein-Gott-Glauben mit in die Wiege gelegt haben, glauben die Christen an das seltsame Konstrukt »Ein Gott - Drei Personen«. Sondern auch, weil Jesus selbst großen Wert darauf gelegt hat: »Ich und der Vater sind eins!« (Joh 10, 30).
Drei Personen - aber nur ein Wesen. Das wird manchmal mit dem »Genus«-Begriff erklärt: So wie es verschiedene Löwen gibt, aber eben nur eine Löwenart, sei es auch bei Gott. Es gibt verschiedene Menschen, aber nur eine Menschheit; verschiedene göttliche Personen, aber nur eine Gottheit. Aber diese Erklärung hat die Kirche als Irrlehre verworfen. Gott ist tatsächlich auch zahlenmäßig nur einer; das ist Dogma. Es muss also immer noch heißen: »Drei Personen, aber nur ein Gott.« Diese Einheit ist also eine einmalige Sache, für die wir in dieser Welt kein vergleichbares Beispiel finden.
c. Wer ist der Vater? â Allgemeine Verwirrung liefert vor allem die unterschiedliche Bezeichnung Gott, Vater, Jesus, Sohn und Kinder Gottes: »Wenn Gott ein Vatergott ist, und wir seine Kinder - wer ist dann Jesus?« Vor allem der gutgemeinte Gedanke, dass alle Menschen Kinder Gottes seien - und Gott eben ein väterlicher Gott ist, setzt Jesus nun wirklich zwischen alle Stühle: »Wenn Jesus Gott ist, ist er dann auch ein Vater?«
Der allgemeine Fehler, der uns Christen allerdings sprachlich auch immer wieder unterläuft, ist, die Väterlichkeit als eine Eigenschaft unseres Gottes anzunehmen. »Das erste, was von Gott im Credo ausgesagt wird, ist seine Väterlichkeit« heißt es manchmal sogar. Wir haben also einen Gott, und dieser eine Gott ist eben ein väterlicher Typ. So weit, so falsch. Tatsächlich ist die »Väterlichkeit« keine Eigenschaft. Sondern in Gott ist ein »Vater«! Eben in Person, nicht nur in Funktion. Gott ist in sich Vater - aber nicht identisch damit, denn er ist auch noch der Sohn und der Geist. Wenn wir also von dem Gott der Christen reden, dann dürfen wir diesen nicht allein mit dem Vater identifizieren, denn der Gott der Christen beinhaltet eben die Person des Vaters und des Sohnes und auch die des Heiligen Geistes. »Vater« zu sein, ist also nicht die Eigenschaft des christlichen Gottes, sondern eine Person - neben den anderen, Sohn und Geist.
a. Gott ist Geschehen. â Wir sollten also im gleichen Maße wie von »Gott, dem Vater« auch von »Gott, dem Sohn« und »Gott, dem Heiligen Geist« sprechen. Mal ehrlich: Das fällt uns schwer. Wir haben den Vater so sehr mit dem ganzen Wesen Gottes identifiziert, dass wir bei dessen Erwähnung immer sofort ein abgeschlossenen Bild von Gott vor Augen haben - und Jesus ist dann irgendwie draußen vor. Besser wäre es, wenn wir - solange wir Gott in seinem Wesen beschreiben wollen - nicht vom »Vater« sprechen. Sondern vom »familiären Gott«, oder - noch besser - vom »beziehungsreichen Gott«. Denn Gott ist in sich ein familiäres, lebendiges und liebevolles Geschehen.
Im Gegensatz zu anderen monotheistischen Religionen oder Sondergruppen ist der christliche Gott ein Gott voller Leben. Jeder andere, einpersonale Gott ist ein seiner Ewigkeit irgendwie auch kalt und starr: So ein monolithischer Gott existiert so vor sich hin. Der christliche Gott aber ist in sich Geschehen, Leben: Der Vater zeugt den Sohn, der Sohn verdankt sich dem Vater, beide hauchen den Geist, der Vater und Sohn in Liebe verbindet⦠das ist Leben und Liebe, nicht nur bloße Existenz. Während in anderen Weltanschauungen der eine (einzige und einsame) Gott den Menschen erschaffen muss, um nicht vor lauter Einsamkeit und Unveränderlichkeit verrückt zu werden, ist der dreifaltige Gott mit sich selbst bestens zufrieden⦠die Erschaffung der Welt und des Menschen ist eine Erweiterungen dieses göttlichen, vor Liebe überfließenden Lebens, nicht die Rettung der Existenz eines suizidalen Gottes.
b. Das Band der Liebe: Gott ist Familie. â Ist das nicht etwas eng - wenn sich drei Personen nur ein Wesen (ein Gott) teilen müssen? Das Gefühl der Enge verstärkt sich noch, wenn wir bedenken, dass diese drei Personen nach außen hin immer mit einer Stimme sprechen, nur einen Willen zeigen und nur gemeinsam agieren. Engt das nicht die Willensfreiheit der jeweiligen Personen ein? Ob diese »Enge« wie ein Käfig ist, hängt davon ab, was diese drei verbindet. Ist es nur das gemeinsame Schicksal (»mitgefangen, mitgehangen«), dann wird sich wohl keiner der drei vergnügt damit abfinden. Wenn aber - und das ist ja unser Glaube - das Band, das die Drei verbindet, das Band der Liebe ist, dann ist Enge und Nähe und Einheit die Erfüllung der Liebe. Dann ist die gegenseitige Unterordnung nicht Folge der Liebe, sondern die Liebe selbst.
Gott ist die Liebe (1 Joh 4, 8); das bedeutet nicht nur, dass Gott sich zu anderen »lieb verhält«, sondern dass das innere Wesen Gottes - die Art, wie die Dreifaltigkeit gestrickt ist - Liebe ist. Die Enge, die dazu führt, dass Gott zwar drei Personen ist, aber doch nur ein Wesen, ist keine drangvolle Enge. Sondern liebende Zärtlichkeit.
Im ersten Schöpfungsbericht heißt es: »Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere auf dem Land. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild; als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie.« (Gen 1, 26f) Dass Gott hier im Plural spricht, mag ein sogenannter pluralis deliberationis (im Sinne von: »Na, dann wollen wir mal⦫) sein; aber die frühen christlichen Theologen haben darin einen tieferen und schöneren Sinn gesehen: Gott spricht im Plural, weil er in diesem Augenblick den Menschen als Abbild der Dreifaltigkeit schafft (»nach unserem Abbild«): Als Mann und Frau. So, wie in Gott die Liebe die Personen verbindet, hat er auch den Menschen geschaffen: Als ein Wesen, dass sich in Liebe verbindet und zu einer neuen Einheit berufen ist: Zur Familie. Das eigentliche Bild Gottes ist also weder der Mann, noch die Frau, sondern beide in Liebe verbunden. (Natürlich darf man nicht der Versuchung erliegen, die Dreifaltigkeit als »Vater, Mutter, Kind« zu deuten - auch wenn manche moderne Theologen dem Geist durchaus weibliche Eigenschaften zuordnen.)
Offensichtlich hat Mohammed, der das Christentum nur flüchtig kennen lernte, eine solche Vorstellung von der christlichen Dreifaltigkeit: Dass dort »Gottvater, Gottmutter und Gottkind« vereint seien. Das lehnte er ab - nachvollziehbar. Bis auf den heutigen Tag gilt für die Muslime daher die Dreifaltigkeit als eines der größten Ärgernisse des christlichen Glaubens. Die Ebenbildlichkeit besteht dagegen nicht darin, dass wir eine Kopie Gottes sind (oder, noch billiger: Dass wir in Gott eine Kopie des Menschen sehen). Sondern im Zusammenspiel von Freiheit, Liebe und Gehorsam - von Geist, Person und Einheit.
Vielleicht erkennen wir jetzt, warum die Christen immer die Familie als »Keimzelle der Gesellschaft« angesehen haben; die Sexualität so hoch schätzen, die Ehe unantastbar halten usw.: Wir bewahren unsere Würde nur, indem wir unsere Gottebenbildlichkeit schützen.
Aus diesem Gottesbild entspringt auch die ganze Fülle des christlichen Glaubens: Denn durch die Taufe sind wir Christus gleichgestaltet (also in die Dreifaltigkeit aufgenommen), durch die Eucharistie werden wir in der Christusförmigkeit erhalten, in der Ehe werden Mann und Frau zum Bild der Liebe Gottes (»Mann und Frau und Frau und Mann / reichen an die Gottheit âran« - Zitat aus der Zauberflöte); die Kirche ist die Teilhabe am Leib und damit Teilhabe an der Dreifaltigkeit, diese Teilhabe ist Himmel.
a. Gott als Vater anreden? â Nun mag die Korrektur unserer Gottesanrede (»Sag nicht Vater, wenn du Gott meinst!«) zwar theologisch gerechtfertigt sein, aber Jesus hat uns eben ein anderes Gebet gelehrt. »Wenn ihr betet, dann sprecht: Unser Vater« - und in der Kirche gilt: »lex orandi, lex credendi« (was wir beten, das glauben wir auch). Aber auch das ist nur auf den ersten Blick ein Widerspruch: Solange wir unseren Glauben rechtfertigen und zu Nicht-Christen sprechen, ist es wichtig, Gott nicht ausschließlich mit dem Vater zu identifizieren, sondern den Sohn und den Geist mitzuerwähnen. Aber für unsere christliche Existenz rückt der Vater in das Zentrum des Gebetes und der Liturgie (das Hochgebet in der Hl. Messe ist beispielsweise ausschließlich an den Vater gerichtet). Aus einem einfachen Grund: Wir treten in die göttliche Familie - in die Dreifaltigkeit -, indem wir den Platz des Sohnes einnehmen. In der Taufe werden wir »Kinder Gottes«, so wie Jesus der Sohn Gottes ist. Wir werden auf den Tod und die Auferstehung Jesu getauft und damit »Christus gleichgestaltet«. Nun können wir - wie Jesus - zum Vater reden; denn wir sind jetzt selbst »Söhne«.
An dieser Stelle ist es sinnvoll, einen kleinen Ausflug in die sogenannte Reform der »inklusiven Sprache« zu machen. In den letzten Jahren wurden viele liturgische Texte daraufhin untersucht und korrigiert, ob sie nur männliche Adressaten haben (indem wir z.B. immer nur von den »Brüdern« sprechen und dabei die »Schwestern« vergessen). Was für »Brüder und Schwestern« richtig sein mag, lässt sich nicht so ohne weiteres auf die »Söhne und Töchter« Gottes übertragen. Denn wir sind zunächst Kinder Gottes durch den Sohn Jesus Christus; wir treten an seine Stelle und werden ihm gleich - egal, ob wir Männer oder Frauen sind. Wenn wir also das (zugegebenermaßen augenfällige) Ärgernis belassen, von uns als den »Söhnen Gottes« zu sprechen, erinnert uns das daran, dass wir alleine durch Christus und durch die Taufe auf ihn in die Dreifaltigkeit aufgenommen worden sind.
Hier schließt sich auch der Bogen zu den Sakramenten der Taufe und Eucharistie: Durch die Taufe wurden wir zuinnerst mit Christus verbunden und haben im Heiligen Geist wirklichen Anteil an seiner Beziehung zum Vater. In der Feier der Eucharistie vollziehen wir genau dies. Für die »Außenansicht« ist es also wichtig, von Gott nicht nur als Vater zu sprechen. Für unsere christliche »Innenansicht« ist es dagegen gerade die besondere Gnade, Gott »Vater« nennen zu dürfen.
b. Die Geistvergessenheit â Wenn wir also wie Christus werden und dann zum Vater beten - wo bleibt denn da der Geist? Warum vergessen wir ihn so oft? Nun, der Geist ist derjenige, der bewirkt, dass wir wie Christus werden. Und weil er derjenige ist, der in uns wirkt, vergessen oder übersehen wir ihn leicht. Er ist uns so nahe, wie wir uns selbst oft nicht sind. So ähnlich, wie man die Kleidung, die man am Körper trägt, nach einer gewissen Zeit nicht mehr spürt, weil man sich daran gewöhnt hat (es sei denn, sie passt nicht). Da der Heilige Geist aber sehr wohl »passt«, d.h. sich ganz auf unser Wesen einstellt, auf unser Können und Nicht-Können, und zudem sehr höflich ist und nichts gegen unser Wollen unternimmt, ist er so eine Art »undercover agent«. Zu dieser Rolle als V-Mann (Verbindungsgarant) lohnt sich ein eigener Abend hier im Grundkurs zum Heiligen Geist (»Pneumatologie«).
Aber auch, wenn der Heilige Geist sich nicht so sehr daran stört, dass er oft vergessen wird, sollten wir ihm mehr Aufmerksamkeit schenken. Zwar ist gerade das »Unerkannte« seine Art der Nähe; zudem gibt es in der Dreifaltigkeit keinen Neid. Aber uns tut es gut, sich das Wirken das Geistes des öfteren vor Augen zu halten. Denn sehr schnell beschleicht uns in Leidsituationen das Gefühl, von allen guten Geistern verlassen zu sein - auch von Gott und Seinem guten Geist. Dann klagen wir, dass wir Gott gar nicht mehr spüren. Dass sich eine Kälte in uns ausbreitet, dass wir Sein Licht nicht mehr sehen - und ähnliches. Dann tut es gut, sich daran zu erinnern, dass der Geist Gottes großen Wert darauf legt, dass er nicht spürbar weht - sondern ganz leise und fast unhörbar. Und dann ist es auch ein hilfreicher Gedanke, dass wir die Kälte und geistige Windstille nur deshalb spüren, weil Gott uns immer noch einen Sinn für IHN gibt.
c. Ist das nicht unvernünftig? â Es gibt ein Dogma der katholischen Kirche, das besagt, dass die Dreifaltigkeit nicht »von alleine«, d.h. ohne die Offenbarung Gottes erkannt werden kann. Das meint: Auf die Idee, dass Gott Drei in Einem ist, kommt keiner nur durch bloßes Nachdenken. Und selbst, wenn wir erkannt haben, dass es drei Personen in Gott gibt, werden wir es niemals wirklich begreifen. Dass wir da nicht von alleine drauf kommen, lässt sich ja noch mit unserem gesunden Menschenverstand nachvollziehen. Das heißt aber nicht, dass es nicht vernünftig ist.
Ich komme auch nicht durch bloßes Nachdenken auf die Anzahl der Saturnmonde. Da muss ich schon hingucken. Aber wenn mir jemand sagt, der Saturn hätte 28 Monde, dann ist das - obwohl ich es glauben muss - nicht unvernünftig.
Aber wenn mir jemand sagt, dass ich die Dreifaltigkeit niemals verstehen werde, dann klingt das doch sehr nach einem »Denkverbot« oder zumindest einem Eingeständnis, dass wir etwas »Unvernünftiges« glauben. Widerspricht das aber nicht dem Wesen Gottes - und dem Wesen des Menschen? Nun, die »Vernünftigkeits-Annahme« für Gottes Wesen hat weiterhin Gültigkeit (wenn wir die aufgeben, können wir von Gott alles aussagen - auch, dass er existiert und gleichzeitig nicht existiert); aber das bedeutet nicht, dass wir alles mit unserer menschlichen Vernunft begreifen und erhellen können. Gott übersteigt die menschliche Vernunft - aber er ist nicht unvernünftig. Die Lehre der Dreifaltigkeit ist übervernünftig (supra rationes), aber nicht widervernünftig (contra rationem). Was auf den ersten Blick wie Wortklauberei klingt, ist in Wirklichkeit etwas ganz Alltägliches. So haben wir uns daran gewöhnt, Liebe zu erkennen und zu leben, obwohl wir zugeben, dass keiner richtig definieren kann, was Liebe eigentlich ist. Ja, wir glauben sogar, dass derjenige, der glaubt zu wissen, was Liebe ist, davon eigentlich nichts verstanden hat.
Das christliche Gottesbild ist zwar in der Offenbarung des Alten Testamentes angedeutet, die Größe und Herrlichkeit (vor allem des Dreifaltigen Gottes) wurde uns aber erst durch den Sohn geoffenbart. Gott ist in sich Beziehung und lädt uns zur Teilnahme am innersten Geschehen der Dreifaltigkeit ein.